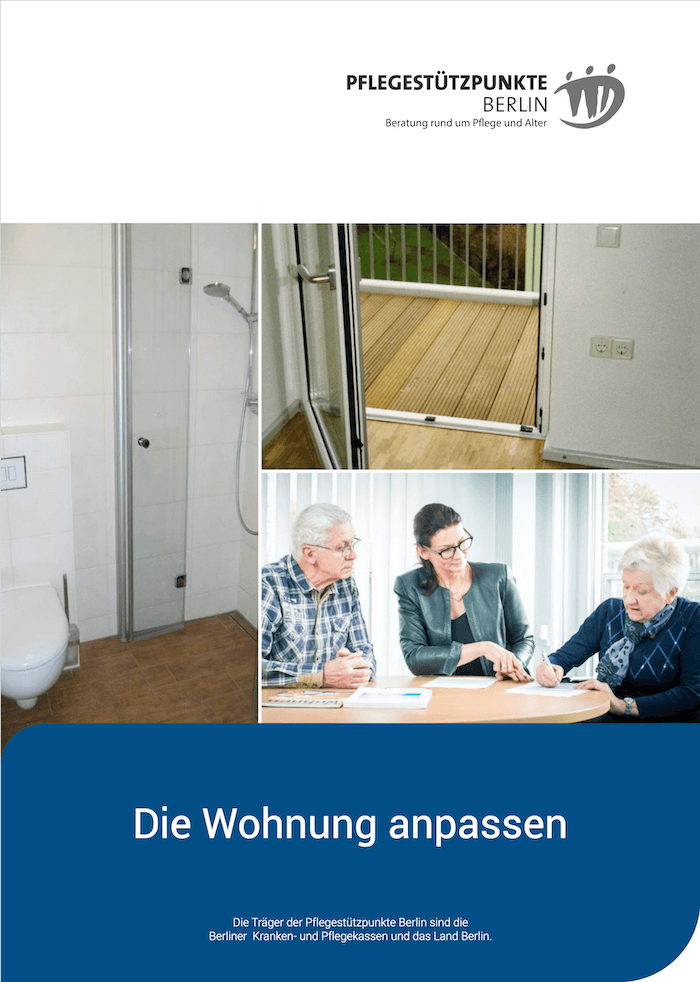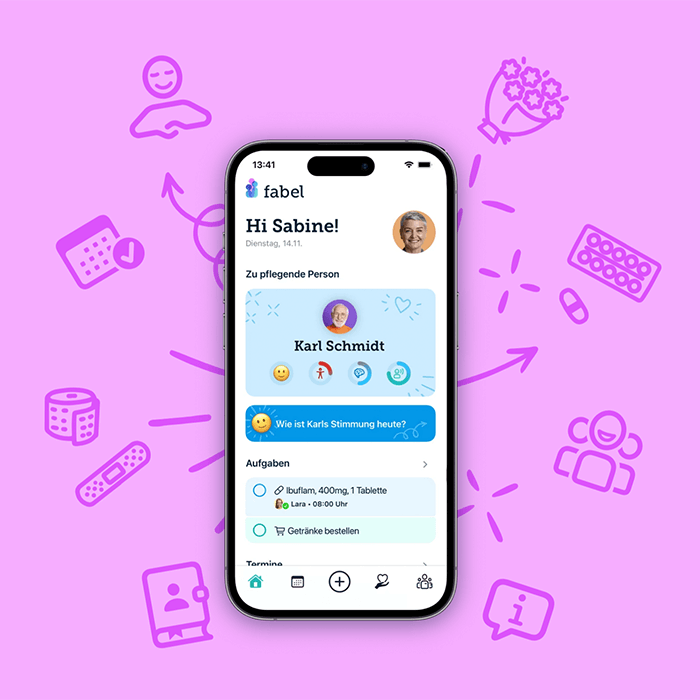Kostenlose Beratung, Wohnungsanpassung und Unterstützung im Pflegedschungel: Was Berlins 36 Pflegestützpunkte leisten und warum viele noch nie von ihnen gehört haben.
Wenn die eigene Mutter plötzlich die Treppe nicht mehr hochkommt, der Nachbar nach einer Hüft-OP nicht weiß, wie es weitergehen soll, oder man selbst merkt, dass der Alltag zu Hause immer schwieriger wird: Wo findet man Hilfe? In Berlin gibt es eine Anlaufstelle, die viele nicht kennen, obwohl sie über 100.000 Menschen pro Jahr berät: die Pflegestützpunkte.
Andrea Didszun leitet den Pflegestützpunkt in Pankow. Als Sozialarbeiterin, Gerontologin und zertifizierte Wohnberaterin berät sie seit vielen Jahren Menschen in allen Fragen rund ums Älterwerden, Pflege und Wohnen. Besonders das Thema Wohnraumanpassung liegt ihr am Herzen: von technischen Hilfen bis hin zu barrierearmen Umgestaltungen.
Christian Lange ist Pressesprecher der Berliner Pflegestützpunkte. Der ehemalige Journalist setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Menschen erfahren, was Pflegestützpunkte leisten und wie niedrig die Hürden sind, sich dort beraten zu lassen.
Im Gespräch mit LIVVING Chefredakteurin Claudia Mattheis erklären beide, was ein Pflegestützpunkt eigentlich ist, wer sich dort Hilfe holen kann und warum es so wichtig ist, dass auch Nachbarn, Vermieter oder Freunde wissen, dass es diese Anlaufstellen gibt.


Die wichtigsten 5 Erkenntnisse aus dem Interview
Pflegestützpunkte sind Beratungsstellen, keine Pflegeeinrichtungen:
Hier gibt es keine körperliche Pflege, sondern kostenlose Beratung zu allen Fragen rund um Pflege, Alter und Wohnen – für jeden zugänglich.
Berlin ist ausgezeichnet aufgestellt:
36 Pflegestützpunkte in ganz Berlin bieten wohnortnahe Beratung, eine Dichte, die bundesweit Seltenheitswert hat.
Wohnen ist ein Schlüsselthema:
Bei fast 20 Prozent aller Beratungen spielt Wohnraumanpassung eine zentrale Rolle: von Stolperfallen bis zur barrierearmen Badumgestaltung.
Rechtzeitig handeln ist entscheidend:
Wer erst handelt, wenn die Mobilität stark eingeschränkt ist, hat kaum noch Handlungsoptionen für einen Wohnungswechsel oder bauliche Anpassungen.
Verdrängen ist weit verbreitet:
Selbst pflegende Angehörige kennen die Pflegestützpunkte oft nicht oder schieben die Beschäftigung mit dem Thema weit hinaus, bis eine Krise entsteht.
Warum wir Andrea Didszun und Christian Lange eingeladen haben
Weil sie zeigen, dass es in Berlin ein dichtes Netz an Unterstützung gibt, das viel zu wenig bekannt ist. Weil sie Menschen helfen, selbstbestimmt zu Hause zu leben, so lange es geht. Und weil sie verdeutlichen, dass rechtzeitige Beratung nicht nur Krisen verhindert, sondern auch Lebensqualität erhält.
Was ist eigentlich ein Pflegestützpunkt?
Beratung statt Wadenwickel
„Der Terminus Pflegestützpunkt ist oft so bisschen verwirrend oder irreführend”, erklärt Christian Lange gleich zu Beginn. „Viele Menschen denken, ein Pflegestützpunkt würde sich mit körperlicher Pflege beschäftigen. Das tun wir gar nicht. Also bei uns gibt es keine Wadenwickel oder keine Rollstuhlfahrt, sondern wir beraten zu Themen rund um Pflege und Alter, die das Versorgungssystem betreffen.”
Das Angebot ist niedrigschwellig und kostenlos: „Zu uns kann jeder Mensch kommen, und zwar kostenlos und zu jeder Zeit im Prinzip, zu offenen Sprechzeiten, der sich im Vorfeld mit dem Thema Pflege und Alter beschäftigen möchte oder bei dem es, das ist dann relativ häufig der Fall, schon so weit gekommen ist, dass es einen pflegebedürftigen Fall vielleicht in der Familie gibt oder man selber pflegebedürftig geworden ist.”
Beeindruckende Zahlen für Berlin
Die Berliner Pflegestützpunkte sind bundesweit vorbildlich aufgestellt: „Es gibt 36 Pflegestützpunkte in Berlin”, erklärt Christian Lange. „Es gibt Pflegestützpunkte auch in fast allen anderen Bundesländern, aber in der Regel nicht in so einer Dichte, wie wir sie hier in Berlin haben. Pro Stützpunkt kann man grob rechnen 100.000 Einwohner.”
Die Nachfrage ist enorm: „Wir hatten über 100.000 Beratungen im letzten Jahr und von diesem Personenkreis sind ungefähr zwei Drittel pflegende Angehörige und ein Drittel pflegebedürftige.”
In welcher Situation kommen Menschen zur Beratung?
Von präventiver Vorsorge bis zur akuten Überlastung
Die Ratsuchenden kommen in ganz unterschiedlichen Phasen. Manche suchen frühzeitig Rat, wenn sich erste Veränderungen abzeichnen: „Eine Gruppe kommt tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo sich abzeichnet, hier verändert sich was, hier entwickelt sich ein Pflegefall mit Unterstützungsbedarf und mit der Frage, was kann ich tun, welche Hilfen gibt es und wie finde ich auch den Zugang in das Versorgungssystem, wie kann ich ein Pflegegrad beantragen, wie kann ich Haushaltshilfen organisieren”, erklärt Andrea Didszun.
Deutlich häufiger allerdings kommen Menschen erst, wenn die Situation bereits belastend geworden ist: „Die zweite Gruppe ist diejenige, die zu uns kommt, wenn tatsächlich schon Pflege länger eine Rolle spielt und in der Familie Belastungsfaktoren schon entstanden sind. Oder einfach mit Pflegesituationen, die sich entwickelt haben, wo Pflegeangehörige schon über ihre Grenze gegangen sind oder aber auch Unterstützungsgrenzen im häuslichen Umfeld sich zeigen.”
Wohnen: Das Schlüsselthema bei 100.000 Beratungen jährlich
Fast jede fünfte Beratung dreht sich ums Wohnen
Das Thema Wohnen hat in der Beratung einen enormen Stellenwert. Christian Lange nennt beeindruckende Zahlen: „Wenn wir mal bei diesen rund 100.000 Menschen bleiben, die im Jahr zu uns den Weg finden, dann kann man sagen, dass bei fast 20 Prozent davon das Thema Wohnen in irgendeiner Form eine Rolle spielt.” Das bedeutet rund 20.000 Personen pro Jahr, die sich mit Barrieren in der Wohnung, Pflegeheimplätzen, betreutem Wohnen oder Hilfsmitteln auseinandersetzen.
Die konkreten Fragen sind dabei sehr unterschiedlich. Andrea Didszun schildert typische Situationen: „Meine Mutter ist an Demenz erkrankt, wir haben hier besondere Verhaltensweisen, die uns im Alltag begegnen, wie können wir mit dem Krankheitsbild umgehen oder die an Demenz erkrankte Person fängt an, das Haus zu verlassen, zeigt ungewöhnliche Verhaltensweisen, die vielleicht auch gefährlich sein können. Wo dann die Frage ist, das geht zu Hause nicht mehr.”
Ein weiteres häufiges Szenario entsteht nach Krankenhausaufenthalten: „Wenn ein Sturzgeschehen ist und die Entlassung aus Krankenhaus und Reha ansteht, aber die Wohnung ist voller Schwellen, die Badewanne in der Wohnung ist eigentlich nicht gut oder gar nicht nutzbar durch die Person, die aufgrund eines solchen akuten Ereignisses Unterstützung braucht.”
Der Hausbesuch: Mehr als technische Beratung
Ein Rundgang mit offenen Augen
„Wenn wir als Wohnberaterin in den Haushalt gehen, haben wir die Möglichkeit, wenn die Ratsuchenden das wünschen, so etwas wie einen Rundgang durch die Wohnung zu machen”, erklärt Andrea Didszun. Dabei geht es um weit mehr als die offensichtlichen Probleme.
„Beim Rundgang durch die Wohnung gehen wir dann eben nicht nur ins Bad, um uns die Wanne anzugucken, sondern wir gehen durch die ganze Wohnung und gucken, wo gibt es vielleicht Türschwellen, wo sind Kabel lose verlegt, wo gibt es Läufer, die vielleicht entfernt werden könnten, gibt es in der Küche eine Sitzgelegenheit oder wie ist die Beleuchtung im Flur, da ist häufig nur so ein Hutzellicht, obwohl da eigentlich die Beleuchtung besonders wichtig ist.”
Systemische und ganzheitliche Beratung
Die Beratung geht über rein technische Aspekte hinaus: „Uns geht es vor allen Dingen darum, nicht nur diesen Pflegefokus zu haben und nicht nur zu gucken, aha, hier braucht jemand Grundpflege, da organisieren wir jetzt einen ambulanten Pflegedienst. Der Mensch bleibt ja Mensch, auch wenn ein Mensch pflegebedürftig wird. Da geht es um Teilhabe, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Austausch, da geht es mitunter auch um Wohlfühlen. Den Menschen als Ganzes zu sehen und nicht nur als Teil zum Thema Pflege.”
Finanzierung: Möglichkeiten und Grenzen
Wegfall der KfW-Förderung erschwert Wohnraumanpassung
Andrea Didszun weist auf eine wichtige Lücke hin: „Es gab eine ganze Zeit von der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch einen Zuschuss, solche baulichen Veränderungen mitzufinanzieren. Diese Unterstützung, dieses Programm ist leider jetzt mit der aktuellen Regierung nicht wieder aufgelegt worden. Das heißt, zumindest im Land Berlin haben wir aktuell die Situation, dass im Grunde für Menschen mit Pflegegrad nur der Zuschuss über die Pflegeversicherung in Betracht kommt.”
Weitere Optionen gibt es für Menschen mit Sozialbedarf: „Für Menschen, die sozialbedürftig sind, kämen dann auch noch Finanzierungsmöglichkeiten zum Beispiel über das Sozialamt, über die Teilhabe, wenn eben auch eine Behinderung mit im Spiel ist. Oder aber auch Stiftungen, die spezielle Personengruppen ansprechen.” Allerdings ist der Aufwand dafür nicht zu unterschätzen: „Das ist aber immer mit einem relativ großen Aufwand und auch Nachweispflichten verbunden.”
Das Berliner Problem: Altbau ohne Aufzug
„Altbau ohne Aufzug, das ist ein Riesenthema. Das begegnet uns jede Woche in einer Beratung”, bestätigt Andrea Didszun. „Eben genau die Personen, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben, zweites, drittes, viertes, fünftes OG ohne Aufzug und dann irgendwann die Schwierigkeit haben, die Wohnung zu verlassen.”
Die ernüchternde Wahrheit: „Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen Treppenlift und in Mehrfamilienhäusern ist das im Übrigen eine Maßnahme, die eigentlich gar nicht realisierbar ist aus unterschiedlichen Gründen.”
Alternative Hilfsmittel mit Einschränkungen
Als Alternative bleiben Hilfsmittel: „Da kommen dann gegebenenfalls Hilfsmittel zum Tragen. Treppensteiger, die hier alternativ eingesetzt werden können, aber immer mit dem Haken, dass es eine Person braucht, die diesen Treppensteiger auch bedient. Das heißt eben, das selbstständige Verlassen und wieder Aufsuchen der Wohnung ist damit nicht ohne Weiteres möglich.”
Die Empfehlung: Rechtzeitig handeln
Wer zu spät umzieht, hat keine Wahl mehr
Andrea Didszun bringt das Dilemma auf den Punkt: „Das ist eben ein Aspekt, wo wir sehen, dass es durchaus Sinn macht, sehr rechtzeitig auch darüber nachzudenken, wie möchte ich eben im Alter wohnen. Denn wenn die Situation eintritt, dass die Wohnung nicht mehr gut passt, ist in den allermeisten Fällen auch der Zeitpunkt verpasst, sich nochmal räumlich zu verändern.”
Das Problem verschärft sich durch den Wohnungsmarkt: „Wir sehen diesen angespannten Wohnungsmarkt mit langen Wartezeiten und dem schwierigen Zugang überhaupt zu Wohnungsangeboten. Wenn jemand aus einem jahrzehntealten Mietvertrag vielleicht auch aus einer großen Wohnung kommt und sich verkleinern, sich verändern will, dann stellt das häufig einfach auch ein Kostenproblem dar.”
Scham, Vielfalt und offene Kommunikation
Die ganze Bandbreite menschlicher Situationen
„Da gibt es die ganze Bandbreite”, sagt Andrea Didszun zur Frage, ob Pflege ein schambehaftetes Thema ist. „Wir haben durchaus auch Konstellationen, wo sehr offen gesprochen wird. Ich denke, das entwickelt sich auch gerade. Wir haben ja auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, ‚nachwachsenden Generationen’, wo mittlerweile durchaus auch anders mit diesen Themen umgegangen wird.”
Diversity spielt eine Rolle
„Wir haben in Berlin auch einen großen Anteil an Familien mit Migrationsgeschichte. Auch das kann eine Rolle spielen in dem Zusammenhang, wie ich mit Pflegethemen umgehe, auch über schambehaftete Themen sprechen kann. Auch im Kontext von Diversity ist das mitunter ein Thema, wenn Menschen auch Diskriminierungserfahrung gemacht haben.”
Warum so viele noch nie von Pflegestützpunkten gehört haben
Ein unterschätztes Angebot mitten in der Stadt
Trotz über 100.000 Beratungen jährlich und 36 Standorten in ganz Berlin kennen viele Menschen die Pflegestützpunkte nicht. Christian Lange sieht als Hauptursache das weit verbreitete Verdrängen einer möglichen Pflegebedürftigkeit: „Das begegnet einem immer wieder. Dieses ‚Damit beschäftige ich mich, wenn es so weit ist.’ Das ist bei meinen eigenen Eltern auch so. Es ist ein ganz, ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss.”
Aktive Öffentlichkeitsarbeit als Gegenstrategie
Die Pflegestützpunkte gehen deshalb aktiv auf die Menschen zu: „Wir gehen deswegen als Pflegestützpunkte auch ganz viel dorthin, wo die Menschen sind. Wir sind auf vielen Infoveranstaltungen und Messen, wir sind in den Kiezen unterwegs, wir halten Vorträge in Gemeinden, in Stadtbüchereien, in ähnlichen Institutionen oder Partnerorganisationen, wo die Menschen hinkommen.”
Ein Appell an Nachbarn und Profis
Nachbarschaftliche Aufmerksamkeit ist willkommen
„Das erleben wir gar nicht selten, dass aus der Nachbarschaft eine Meldung kommt”, bestätigt Andrea Didszun. „Ich habe dies und jenes beobachtet und wir dann sagen, sprechen Sie bitte Ihren Nachbarn, Ihre Nachbarin an, sie kann sich jederzeit melden oder wenn die Nachbarin einverstanden ist, können Sie auch uns Bescheid geben. Immer eben sozusagen das Einverständnis vorausgesetzt.”
Wunsch an Arztpraxen und Apotheken
„Was wir uns wünschen, ist eben noch mehr auch aus der professionellen Landschaft, wenn ich zum Beispiel an die Arztpraxen denke, wenn ich an die Apotheken denke, also die Anlaufstellen, wo auch Menschen, die sonst ganz schwer erreichbar sind, die sonst vielleicht auch überhaupt keine sozialen Bezüge mehr haben, doch noch mal anlaufen. Dass also diese Partner das im Blick haben und verweisen könnten auf unsere Pflegestützpunkte.”
Kontakt zu den Berliner Pflegestützpunkten:
- Servicetelefon (kostenfrei): 0800 59 500 59 (Mo-Fr, 9-18 Uhr)
- Website: www.pflegestuetzpunkteberlin.de
- Instagram: www.instagram.com/pflege.fragen/
- Hilfelotse Berlin: www.hilfelotse-berlin.de
- Videoberatungstermine: https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/
- 36 Standorte in ganz Berlin
Weitere Informationen und die Standortübersicht finden Sie auf der Website der Berliner Pflegestützpunkte.
Warum Sie dieses Podcast-Interview hören sollten
Weil Andrea Didszun und Christian Lange zeigen, dass es in Berlin ein dichtes und professionelles Hilfsnetz gibt, das viel zu wenige kennen. Weil sie verdeutlichen, dass rechtzeitige Beratung nicht nur Krisen verhindert, sondern Lebensqualität und Selbstbestimmung im Alter erhält. Und weil sie Mut machen, sich mit dem Thema Pflege und Wohnen im Alter auseinanderzusetzen, bevor es zu spät ist.
Das Interview bietet konkrete Einblicke in die Arbeit der Pflegestützpunkte: Von der Wohnberatung vor Ort über Finanzierungsmöglichkeiten bis zum Umgang mit dem Berliner Altbauproblem. Sie erfahren, wie ein Hausbesuch abläuft, welche Unterstützung möglich ist und warum es so wichtig ist, nicht zu lange zu warten.
Jetzt LIVVING Podcast anhören!
Zum Beispiel mit einem kostenlosen Account bei Spotify:
Kein Account? Kein Problem!
• Sie können alle Podcast-Folgen auch direkt hier auf unserer Webseite anhören
• Klicken Sie dazu einfach rechts im Kasten auf “Inhalt entsperren” und dann auf den Abspielpfeil
• Sie finden uns auch auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.
• Und natürlich gibt es den LIVVING Podcast auf YouTube
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Lieber lesen, als Podcast hören? Interview zum Nachlesen!
Interview mit Andrea Didszun und Christian Lange: Pflegestützpunkte in Berlin, die unterschätzte Hilfe vor der Haustür
Claudia Mattheis:Hallo, herzlich willkommen in meinem LIVVING Podcast Studio. Liebe Andrea Didszun, lieber Christian Lange. Warum ich Sie eingeladen habe? Weil Sie beide ein gemeinsames Ziel verfolgen: Menschen in Berlin dabei zu unterstützen, so lange wie möglich selbstbestimmt und sicher zu Hause leben zu können. Frau Didszun, Sie leiten den Pflegestützpunkt in Pankow und beraten seit vielen Jahren Menschen in allen Fragen rund ums Älterwerden, Pflege und Wohnen. Als Sozialarbeiterin, Gerontologin und zertifizierte Wohnberaterin bringen Sie nicht nur fachliche Tiefe mit, sondern auch einen ganz praktischen Blick für das, was im Alltag wirklich hilft. Besonders das Thema Wohnraumanpassung liegt Ihnen am Herzen, von technischen Hilfen bis hin zu barrierearmen Umgestaltungen. Und Sie, Herr Lange, sind Pressesprecher der Berliner Pflegestützpunkte, kommen ursprünglich aus dem Journalismus und haben viele Jahre für eine gemeinnützige Stiftung gearbeitet. Jetzt setzen Sie sich dafür ein, dass möglichst viele Menschen erfahren, was Pflegestützpunkte leisten und wie niedrig die Hürden sind, sich dort beraten zu lassen. Ich möchte heute mehr erfahren über Ihre Arbeit in den Pflegestützpunkten und nochmal herzlich willkommen im Studio bei mir.
Christian Lange:Ja, vielen Dank für die Einladung.
Claudia Mattheis:Gerne. Starten wir doch gleich mit der allerersten Frage. Was ist eigentlich ein Pflegestützpunkt und was erwartet mich dort? Herr Lange, wollen Sie gleich starten?
Andrea Didszun:Vielen Dank.
Christian Lange:Ich starte mal, weil der Terminus Pflegestützpunkt oft ein bisschen verwirrend oder irreführend ist. Viele Menschen denken, ein Pflegestützpunkt würde sich mit körperlicher Pflege beschäftigen. Das tun wir gar nicht. Also bei uns gibt es keine Wadenwickel oder Rollstuhlfahrten, sondern wir beraten zu Themen rund um Pflege und Alter, die das Versorgungssystem betreffen. Zu uns kann jeder Mensch kommen, und zwar kostenlos und im Prinzip zu jeder Zeit, zu offenen Sprechzeiten, die wir noch mal anschließend angeben können. Das betrifft alle, die sich im Vorfeld mit dem Thema Pflege und Alter beschäftigen möchten oder bei denen es, das ist dann relativ häufig der Fall, schon so weit gekommen ist, dass es einen pflegebedürftigen Fall vielleicht in der Familie gibt oder man selber pflegebedürftig geworden ist. Wir sind Beratungsstellen und keine Pflegestützpunkte in dem Sinne, dass man bei uns körperlich versorgt wird. Wer kommt zu uns? Das sind vor allen Dingen pflegende Angehörige, eine sehr große Gruppe. Wir hatten im letzten Jahr über 100.000 Beratungen.
Claudia Mattheis:In Berlin? Bei wie vielen Pflegestützpunkten?
Christian Lange:Es gibt 36 Pflegestützpunkte in Berlin. Es gibt Pflegestützpunkte auch in fast allen anderen Bundesländern, aber in der Regel nicht in so einer Dichte, wie wir sie hier in Berlin haben, sondern es ist geografisch ein bisschen breiter gestreut. In Berlin haben wir 36 und das ist so pro Stützpunkt, kann man grob rechnen, 100.000 Einwohner. Wir hatten über 100.000 Beratungen im letzten Jahr und von diesem Personenkreis sind ungefähr zwei Drittel pflegende Angehörige und ein Drittel Pflegebedürftige, so über den Daumen gepeilt.
Claudia Mattheis:Das sind ja große Zahlen. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Pflege im Alter, sondern Sie beraten auch Familien mit pflegebedürftigen Kindern oder pflegebedürftigen jüngeren Erwachsenen.
Christian Lange:Das ist auch ein Schwerpunkt, genau. Also man denkt immer bei Pflege an Senioren oder an ältere Menschen, das ist gar nicht nur der Fall. Wir haben viele Menschen, die pflegebedürftige Kinder haben, auch mit teils hohen Pflegegraden. Also hoher Pflegegrad bedeutet, wer Pflegegrad 3, 4 oder 5 hat, braucht massive Unterstützung durch die Familie oder durch andere Dritte. Das ist in diesen Familien häufig der Fall und für die haben wir eine spezialisierte Beratung. Das heißt, Menschen, die Kinder und Jugendliche haben, die sie versorgen müssen, können auch zu uns kommen und bekommen eine spezielle Beratung genau zu diesem Thema.
Claudia Mattheis:Nun reden wir heute aber natürlich passend zu LIVVING über die Pflege von älteren Erwachsenen. Sie hatten ja schon gesagt, an wen sich das Angebot richtet. Also es sind die Betroffenen selbst, die Menschen mit Pflegebedarf, aber es sind auch die Angehörigen. Was mich interessieren würde: In welcher Situation kommen denn die Menschen zu Ihnen? Präventiv oder wenn es im Alltag schon schwierig wird oder wenn man mit der Pflege überfordert ist?
Andrea Didszun:Es gibt zwei Gruppen. Eine Gruppe kommt tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo sich abzeichnet, hier verändert sich was, hier entwickelt sich ein Pflegefall mit Unterstützungsbedarf und mit der Frage: Was kann ich tun, welche Hilfen gibt es und wie finde ich auch den Zugang in das Versorgungssystem, wie kann ich einen Pflegegrad beantragen, wie kann ich Haushaltshilfen organisieren? Das ist die eine Gruppe, die zu Beginn, bei Eintreten einer Unterstützungsbedürftigkeit, Beratung sucht. Die zweite Gruppe ist diejenige, die zu uns kommt, wenn tatsächlich schon Pflege länger eine Rolle spielt und in der Familie Belastungsfaktoren schon entstanden sind oder einfach Pflegesituationen sich entwickelt haben, wo Pflegeangehörige schon über ihre Grenze gegangen sind oder auch Unterstützungsgrenzen im häuslichen Umfeld sich zeigen. Wo der Eindruck entsteht: Ist der Unterstützungsbedarf so groß geworden, dass wir das gar nicht mehr schaffen? Wir haben das Gefühl, das ist unsicher geworden. Das ist die zweite große Gruppe. Und ich bin ja nun schon viele Jahre in diesem Beratungsfeld und wenn ich darüber nachdenke, zu Beginn meiner Berufstätigkeit war es so, dass wir schon noch relativ häufig ratsuchende Seniorinnen und Senioren hatten, die gekommen sind und einfach nur mal fragen wollten: Ach, was kann ich machen für den Fall der Fälle, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich vorsorgen? Diese präventive Beratung gerade der alten und hochaltrigen Personen spielt eher eine untergeordnete Rolle. Also es ist schon eher wirklich dieser Fokus auf Pflege bei unseren Ratsuchenden. Gleichwohl, insbesondere wenn wir pflegende Angehörige, Zugehörige, Familie, Freunde, Nachbarn bei uns in der Beratung haben, sprechen wir nicht selten auch diesen präventiven Aspekt von uns aus an. Einfach mit dem Fokus: Wer pflegt, wer sich kümmert, hat ein erhöhtes Risiko, krank zu werden, physisch, psychisch, hat selber ein erhöhtes Risiko, über kurz oder lang unterstützungsabhängig zu werden. Und da kann Prävention eine große, wichtige Rolle spielen, das zu vermeiden. Darüber nachzudenken: Wo sind meine eigenen Grenzen, wo kann ich auch Hilfe hinzuorganisieren und was kann ich auch für mich tun? In der Rolle als helfende Person in Gemeinschaft zu kommen, sich auszutauschen, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben. Wir kennen ja diese Schlagworte alle, aber wenn das Leben voll ist, gerät eben das Sich-selber-Sorgen manchmal so in den Hintergrund. Auch darüber zu sprechen und Impulse zu geben, gehört schon auch mit dazu.
Claudia Mattheis:Da kann sich sicher jeder was darunter vorstellen. Ich würde jetzt gerne trotzdem noch ein bisschen konkreter werden. Mit welchen Fragen und Sorgen kommen die Leute zu Ihnen? Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele aus Ihrer Arbeit?
Andrea Didszun:Um jetzt bei diesen beiden Gruppen zu bleiben: Diejenigen, die zu Beginn einer Pflegesituation zu uns kommen, sitzen bei uns und sagen: Wie kann ich denn einen Antrag auf Pflegegrad stellen? Oder aber: Ich schaffe es nicht mehr, den Haushalt zu bewältigen und brauche einen Pflegegrad. Das ist dann so diese Einstiegsfrage, wo wir in der Beratung anfangen zu sortieren und zu gucken: Was ist es eigentlich ganz konkret? Was hat sich verändert in der Selbstständigkeit, in der Mobilität, in der Möglichkeit, die Alltagsanforderungen zu bewältigen? Dann gucken wir auch: Was ist jetzt der Weg? Geht es in Richtung Pflege? Sind es eher Unterstützungsoptionen im Alltagsleben? Und dann eben in diese Richtung zu beraten und auch zu begleiten, zum Beispiel sozialrechtliche Leistungsansprüche durchzusetzen. Bei der zweiten Gruppe, wo Pflege schon eine größere Rolle spielt, da geht es dann häufig eher um Fragestellungen wie: Meine Mutter ist an Demenz erkrankt, wir haben hier besondere Verhaltensweisen, die uns im Alltag begegnen, wie können wir mit dem Krankheitsbild umgehen? Oder die an Demenz erkrankte Person fängt an, das Haus zu verlassen, zeigt ungewöhnliche Verhaltensweisen, die vielleicht auch gefährlich sein können. Wo dann die Frage ist: Das geht zu Hause nicht mehr. Was gibt es denn für Alternativen? Und da sind wir dann relativ schnell im Wohnthema, genauso in Konstellationen, wenn ein Sturzgeschehen passiert ist und die Entlassung aus Krankenhaus und Reha ansteht, aber die Wohnung ist voller Schwellen, die Badewanne in der Wohnung ist eigentlich nicht gut oder gar nicht nutzbar durch die Person, die aufgrund eines solchen akuten Ereignisses Unterstützung braucht. Das wären so Themen.
Christian Lange:Wir haben uns vorher noch mal ein bisschen schlau gemacht, was die Zahlen angeht. Wenn wir mal bei diesen rund 100.000 Menschen bleiben, die im Jahr zu uns den Weg finden, dann kann man sagen, dass bei fast 20 Prozent davon das Thema Wohnen in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also entweder, wie gerade gesagt, dass es Barrieren und Hindernisse in der eigenen Wohnung gibt oder dass man sich mit dem Gedanken beschäftigt: Ist es überhaupt noch das Richtige, in dieser Wohnung zu bleiben? Muss ich eventuell doch mich mit dem Gedanken eines Pflegeheimplatzes auseinandersetzen oder einer anderen Wohnform im betreuten Wohnen? Oder nehme ich Hilfsmittel in Anspruch, die mir das Verbleiben in der eigenen Wohnung einfacher machen? Also so rund 20 Prozent, das sind dann ungefähr 20.000 Personen, beschäftigen sich mit diesem Thema, wenn sie zu uns kommen.
Claudia Mattheis:In welcher Verfassung sind die Menschen, die zu Ihnen kommen? Ich habe den Eindruck, dass alle Themenbereiche rund um Pflege ein bisschen schambehaftet sind und dass auch in der Familie das gerne verdrängt wird und man nicht gerne darüber sprechen will, obwohl viele ja eigentlich Anspruch auf Unterstützung haben. Wie nehmen Sie das wahr?
Andrea Didszun:Da gibt es die ganze Bandbreite. Wir haben in den Beratungen natürlich auch Familien, wo es schwierig ist, dieses Thema zu besprechen, insbesondere wenn ich an Beratungsgespräche mit Angehörigen denke, wo auch die Selbsteinschätzung der pflegebedürftigen Person sehr von dem abweicht, wie Angehörige Situationen sehen, einschätzen, bewerten und sich auch andere Versorgungsmöglichkeiten wünschen als die pflegebedürftigen Personen selber. Wir haben aber durchaus auch Konstellationen, wo sehr offen gesprochen wird. Ich denke, das entwickelt sich auch gerade. Wir haben ja auch die, ich sage mal in Anführungszeichen, nachwachsenden Generationen, wo mittlerweile durchaus auch anders mit diesen Themen umgegangen wird, auch in der Familie offen gesprochen werden kann. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab: Was bringen die Familien für Hintergründe mit? Wie sind sie sozialisiert? Wie sind sie auch miteinander in der Vergangenheit umgegangen mit Themen, die ja mitunter herausfordernd sind? Was für eine Kultur steckt dahinter? Wir haben in Berlin auch einen großen Anteil an Familien mit Migrationsgeschichte. Auch das kann eine Rolle spielen in dem Zusammenhang, wie ich mit Pflegethemen umgehe, auch über schambehaftete Themen sprechen kann. Auch im Kontext von Diversity ist das mitunter ein Thema. Wenn Menschen auch Diskriminierungserfahrung gemacht haben, sprechen diese Personen womöglich anders über Bedarfe und Bedürfnisse als Personen ohne Diskriminierungserfahrung. Da versuchen wir schon sehr offen, sehr systemisch denkend ins Gespräch zu gehen und zu gucken: Was bringen die Menschen mit? Worüber sprechen sie? Was können wir noch auch im Gespräch hervorholen an Wünschen, an Vorstellungen? Und darüber nachzudenken, welche Optionen haben Personen, eben ihre jeweilige Lebenssituation gut zu organisieren. Wir sind in der Beratung immer daran interessiert, nicht unsere Vorstellung einer guten Pflege oder eines guten Wohnens rüberzubringen, sondern den Menschen Optionen mit auf den Weg zu geben, mit denen sie dann für sich gute Entscheidungen treffen können, einen möglichst hohen Grad an Lebensqualität trotz einer veränderten Situation für sich hinzukriegen.
Claudia Mattheis:Was ich raushöre ist, es ist also deutlich mehr als nur eine reine technische oder bauliche Beratung, was Sie machen. Sie beraten also auch quasi, ja fast wie ein Mediator, wenn Sie merken, da kommt eine Familie mit Geschichte und da gibt es Pflege oder eher nicht. Oder moderieren Sie auch Gespräche?
Andrea Didszun:Ganz so würde ich es nicht formulieren. Wir sind keine Mediatorinnen, wir sind auch keine Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen. Da gibt es, wenn solche Bedarfe sind, gegebenenfalls auch noch weitere spezialisierte Beratungsangebote hier in Berlin, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann auch verweisen und überleiten können. Uns geht es vor allen Dingen darum, nicht nur diesen Pflegefokus zu haben und nicht nur zu gucken: Aha, hier braucht jemand Grundpflege, da organisieren wir jetzt einen ambulanten Pflegedienst. Aha, hier kommt jemand nicht in die Badewanne, da organisieren und bereiten wir vor, dass die Badewanne zur pflegegerechten Dusche umgebaut wird. Das ist ein Teil, aber der Mensch bleibt ja Mensch, auch wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, auch wenn ein pflegender Angehöriger sich sorgt. Und da spielen ja immer auch noch andere Facetten des Lebens mit hinein. Da geht es um Teilhabe, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Austausch, da geht es mitunter auch ums Wohlfühlen. Und da so ein Gesamtpaket zu besprechen, das ist das, was wir im Sinn haben. Also den Menschen als Ganzes zu sehen und nicht nur als Teil zum Thema Pflege.
Claudia Mattheis:Sie bieten diese Beratung bei Ihnen, also bei sich in den Pflegestützpunkten an. Es gibt eine Online-Beratung und Sie machen aber auch Hausbesuche. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Sie kommen jetzt zu mir nach Hause und was machen Sie dann?
Andrea Didszun:Der Hausbesuch, das ist sicherlich nochmal so ein ganz besonderes Angebot auch in den Berliner Pflegestützpunkten, eben immer dann für Ratsuchende interessant, einerseits, wenn sie den Weg nicht zu uns in die Beratungsstellen oder die Außensprechstunden finden, Videoberatung nicht gewünscht ist und insbesondere natürlich immer, wenn es um Wohnberatung geht, also wirklich auch diese bauliche Wohnungsanpassung, pflegegerechte Anpassung. Denn da kann man aus der Ferne sicherlich allgemein sprechen, was es so für Möglichkeiten gäbe. Aber wenn wir als Wohnberaterin in den Haushalt gehen, haben wir die Möglichkeit, wenn die Ratsuchenden das wünschen, so etwas wie einen Rundgang durch die Wohnung zu machen. Also einmal die Wohnung zu durchschreiten und zu gucken und zu thematisieren: Was fällt uns dabei schon auf? Es ist häufig so, ob es das Wohnthema ist oder ob es auch andere Themen sind, die Menschen kommen mit einer Fragestellung zur Tür herein und daraus ergibt sich dann häufig viel, viel mehr. Diese Geschichte: Ich habe nun mal eine kurze Frage in der Sprechstunde, endet häufig in einer einstündigen Beratung. Das ist so unsere Erfahrung, weil wir natürlich vieles abfragen, viele Themen von uns aus ansprechen. Und so ist es eben in der Wohnberatung auch. Beim Rundgang durch die Wohnung gehen wir dann eben nicht nur ins Bad, um uns die Wanne anzugucken, sondern wir gehen durch die ganze Wohnung und gucken: Wo gibt es vielleicht Türschwellen? Wo sind Kabel lose verlegt? Wo gibt es Läufer, die vielleicht entfernt werden könnten? Wie ist die Beleuchtung im Flur? Da ist häufig nur so ein Hutzellicht, obwohl da eigentlich die Beleuchtung besonders wichtig ist. Gibt es in der Küche eine Sitzgelegenheit? Also wir haben die Möglichkeit, wenn die Ratsuchenden das möchten, uns einfach einen umfassenden Eindruck in der Wohnung, in dem Haus zu verschaffen und Impulse zur Umsetzung zu geben. Das ist auch meine Erfahrung: Die Menschen können eben nur gute, für sich passende Entscheidungen treffen, wenn sie ihre Möglichkeiten kennen. Und woher sollen sie davon wissen? Das sind ja alles Themen, mit denen sich Menschen jetzt im Normalen eher nicht befassen, sondern diese Themen werden dann relevant, wenn sich eben Gesundheit verändert, wenn sich Mobilität verändert und dadurch zum Beispiel auch Sturzrisiken hinzutreten. Und da ist vielleicht noch mal interessant auch zu wissen: Neben dieser spezialisierten Beratung für Familien mit pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen haben wir genauso eben eine spezialisierte Beratung zum Thema Wohnen. Die Wohnberatung zu pflegegerechtem Umbau gibt es auch an zwölf Standorten in jedem Bezirk als Anlaufstelle, wo auch die entsprechend geschulten Mitarbeitenden sitzen und die Expertise mitbringen.
Claudia Mattheis:So, jetzt sind Sie bei mir in der Wohnung, sind jetzt da durchgeschritten und haben an verschiedenen Stellen im Flur, in der Küche, im Bad und im Wohnzimmer festgestellt, da kann man was verändern. Erstellen Sie dann einen Bericht mit Kostenvoranschlag und Empfehlung von Anbietern oder was passiert denn dann?
Andrea Didszun:Das ist ganz individuell. Das hängt letztlich von Ihnen als Ratsuchende ab, was Sie sich wünschen, was Sie brauchen. Wer selbstständig ist und die Umsetzung selber organisieren kann, der tut das dann in der Regel auch. Wir agieren nur insoweit, als unsere Ratsuchenden das im Kontext von Unterstützung tatsächlich brauchen. Aber wenn es jetzt wirklich beispielsweise um bauliche Veränderungen geht, Entfernung der Türschwellen im Altbau, dann kann es im Verfahren schon so sein, dass wir im Gespräch vereinbaren, dass wir als Pflegestützpunkt zum Beispiel Firmen benennen, die in dieser Art des Umbaus eine Erfahrung mitbringen. Dann würde abgestimmt werden: Wer kümmert sich um die Einholung eines Kostenangebotes oder von zwei, drei Vergleichsangeboten? Macht das die ratsuchende Person selber oder unterstützen wir als Beraterin mit Einverständnis der Ratsuchenden hierbei? Gleiches gilt für die Einholung der Zustimmung des Vermieters.
Claudia Mattheis:Genau, da ganz kurz die Frage: Ist das denn alles erlaubt? Wenn Sie jetzt so sagen, es wird jetzt die Badewanne entfernt und dafür ist eine bodentiefe Dusche drin oder die Schwellen werden entfernt, muss der Vermieter dem zustimmen?
Andrea Didszun:Das Bürgerliche Gesetzbuch hat dazu tatsächlich eine Regelung, die auch jüngst noch mal angepasst wurde, eben die Rechte der Mieterinnen zu stärken, wo eben geschrieben steht, wenn es aufgrund von Gesundheit oder Behinderung nötig ist, einen solchen Umbau zu machen, soll der Vermieter zustimmen. Einen Absatz weiter heißt es aber auch: Wenn es Gründe gibt, die dagegen sprechen, kann der Vermieter diese Zustimmung auch verweigern. Das ist ein weites Feld. Also es gibt keinen Anspruch auf Vermieterzustimmung für solche Umbauten. Und genauso sehen wir das auch in der Praxis, wenn Vermietende angefragt werden. Da gibt es an der einen Stelle sofort eine Zustimmung, an der nächsten Stelle eine Zustimmung mit Rückbauforderung und durchaus auch Ablehnung, ja.
Claudia Mattheis:Aber Sie begleiten bei Bedarf und auf Wunsch den gesamten Prozess, vom Vorschlag, was gibt es für Möglichkeiten, bis zu wie kann man es machen und dann auch, wie kann man es finanzieren. Wie kann man es denn finanzieren? Also ohne Pflegegrad gibt es gar keine Finanzierungsmöglichkeiten oder doch? Oder braucht man einen Pflegegrad dafür?
Christian Lange:Also der Pflegegrad ist leider Voraussetzung. Bitte korrigiere mich, Andrea, falls ich was Falsches sage. Und es gibt einen Zuschuss in Höhe von 4.180 Euro, den man beantragen kann. Das klingt jetzt erst mal gar nicht so wenig. Aber wir haben hier schon ein paar Themen angesprochen. Also wenn man mal so einen Wohnungsrundgang macht, ich bin da auch mal mit dabei gewesen bei einigen, dann stellt man schon fest, dass es viele Punkte in der Wohnung gibt, auf die die Menschen, die dort drin wohnen, gar nicht kommen. Also die nehmen das so ein bisschen so wie gottgegeben hin. Und dann stellt man fest, da gibt es ja noch diesen und jenen Punkt, da könnte man auch was machen. Also diese 4.180 Euro sind natürlich relativ schnell aufgebraucht. Trotzdem ist es eine finanzielle Unterstützung. Und der Pflegegrad, der erst mal vorher durch den Medizinischen Dienst festgestellt werden muss, der ist dafür in der Tat Voraussetzung.
Andrea Didszun:Es gab eine ganze Zeit von der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch einen Zuschuss, solche baulichen Veränderungen mitfinanzieren zu können. Diese Unterstützung, dieses Programm ist leider jetzt mit der aktuellen Regierung nicht wieder aufgelegt worden. Das heißt, zumindest im Land Berlin haben wir aktuell die Situation, dass im Grunde für Menschen mit Pflegegrad nur der Zuschuss über die Pflegeversicherung in Betracht kommt. Aber auch das ist eine Kannleistung. Da entscheidet immer auch die Pflegekasse im individuellen Fall, ob dieser Zuschuss geleistet wird. Und das hängt auch immer von der jeweiligen Situation ab, ob das dann zum Tragen kommen kann. In anderen Bundesländern gibt es Zuschüsse eben ergänzend zu der Förderung durch die Pflegekasse. Das müsste man dann eben regional klären, welche Möglichkeiten da bestehen. Und es lohnt sich auch, den Vermieter anzusprechen, zu fragen: Ich habe jetzt dieses oder jenes vor, das könnte auch eine Wohnwertsteigerung mit sich bringen. Lieber Vermieter, kannst du dir vorstellen, dich zu beteiligen? In Berlin, ehrlich gesagt, der Wohnungsmarkt ist super angespannt. Da sind die Zeiten ehrlicherweise vorbei, dass die Vermieter sich hier groß beteiligen. Das war vor Jahren anders, aber aktuell eher nicht. Ansonsten, für Menschen, die sozialbedürftig sind, kämen dann auch noch Finanzierungsmöglichkeiten zum Beispiel über das Sozialamt, über die Teilhabe, wenn eben auch eine Behinderung mit im Spiel ist, oder aber auch Stiftungen, die spezielle Personengruppen ansprechen, die auch solche Maßnahmen mitfinanzieren können. Das ist aber immer mit einem relativ großen Aufwand und auch Nachweispflichten verbunden. Und Sie sehen, es ist eben vieles möglich und immer im individuellen Fall zu begucken, was hier ein gangbarer Weg ist.
Claudia Mattheis:Okay, Berlin ist ja eine Mieterstadt, das heißt, die meisten Menschen wohnen in Mietwohnungen und das ändert sich im Alter auch nicht. Wir haben sehr viele Altbauten, in denen es keinen Aufzug gibt. Auch ältere Menschen wohnen oft im zweiten, dritten oder vierten Stock ohne Aufzug, was dann irgendwann schwierig wird. Gibt es ein Anrecht auf einen Treppenlift, den der Vermieter dann einbauen muss?
Andrea Didszun:Was Sie beschreiben, ein Riesenthema. Das begegnet uns jede Woche in einer Beratung, eben genau die Personen, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben, zweites, drittes, viertes, fünftes Obergeschoss ohne Aufzug, und dann irgendwann die Schwierigkeit haben, die Wohnung zu verlassen. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen Treppenlift und in Mehrfamilienhäusern ist das im Übrigen eine Maßnahme, die eigentlich gar nicht realisierbar ist aus unterschiedlichen Gründen. Da kommen dann gegebenenfalls Hilfsmittel zum Tragen. Treppensteiger, die hier alternativ eingesetzt werden können, aber immer mit dem Haken, dass es eine Person braucht, die diesen Treppensteiger auch bedient. Das heißt eben, das selbstständige Verlassen und wieder Aufsuchen der Wohnung ist damit nicht ohne Weiteres möglich. Und das ist eben ein Aspekt, wo wir sehen, dass es durchaus Sinn macht, sehr rechtzeitig auch darüber nachzudenken: Wie möchte ich eben im Alter wohnen? Denn wenn die Situation eintritt, dass die Wohnung nicht mehr gut passt, ist in den allermeisten Fällen auch der Zeitpunkt verpasst, sich noch mal räumlich zu verändern. Weil sich dann eben immer die Frage stellt: Ist jetzt eine Seniorenwohnung oder betreutes Wohnen überhaupt noch die richtige Wohnform, wenn wirklich schon Unterstützung gebraucht wird? Wir sehen diesen angespannten Wohnungsmarkt mit langen Wartezeiten und dem schwierigen Zugang überhaupt zu Wohnungsangeboten. Wenn jemand aus einem jahrzehntealten Mietvertrag, vielleicht auch aus einer großen Wohnung kommt und sich verkleinern, sich verändern will, dann stellt das häufig einfach auch ein Kostenproblem dar. Deshalb macht es durchaus Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wo geht die Reise hin, was kann ich mir vorstellen.
Claudia Mattheis:Ja, das ist genau das, was ich jetzt in meinen zweieinhalb Jahren bei LIVVING mittlerweile sehr deutlich festgestellt habe. Aber auch, dass die Menschen große Meister im Verdrängen sind und sagen: Ich möchte in meiner eigenen Wohnung so lange wie möglich wohnen bleiben. Und alles wird dann so weit weggeschoben, wie es nur irgendwie geht, bis man keine Handlungsoptionen mehr hat. Und dann hat man tatsächlich ein Problem. Ich glaube, die Altersgruppe, über die Sie jetzt gerade so gesprochen haben, sind wahrscheinlich eher hochaltrige Personen über 80. Und ja, da wird es dann wahrscheinlich schwierig, noch mal umzuziehen. Und den angespannten Wohnungsmarkt hatten Sie ja schon angesprochen. Es gibt also auch kaum Wohnalternativen. Aber was macht man denn dann? Also jetzt mal so ganz simpel gefragt: Da sitzt jetzt eine 83-jährige Frau, allein, lebt zu Hause im vierten Stock. Nach einer Hüft-OP kommt sie nicht mehr runter und nicht mehr hoch. Was passiert denn dann?
Andrea Didszun:Also wir beraten natürlich schon auch zu Wohnalternativen. Es ist nicht so, dass wir das in der Beratung grundsätzlich ausschließen. Wir haben ja in Berlin durchaus auch ein vielfältiges Angebot. Wir haben Seniorenwohnhäuser, wir haben betreutes Wohnen, wir haben die Pflegewohnform mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften und Pflegeheimen. Das sind ja durchaus Optionen und auch Wohnen im Bestand. Also der Umzug in eine besser geeignete Wohnung im Kiez ist denkbar. Was wir in der Beratung aber gerade bei den Menschen, allgemein 80 plus, sehen ist, dass da gar nicht unbedingt der Wunsch, die Bereitschaft oder das Einsehen ist, sich noch mal zu verändern, weil das natürlich auch ein Riesenaufwand ist, so einen Umzug zu bewerkstelligen, Dinge zu packen, sich vielleicht auch zu verabschieden. Auch das spielt da mitunter eine Rolle: den Kiez zu verändern, die Laufwege nicht mehr zu haben, den Arzt, die Freundin, das Nachbarschaftstreffen. Das sind alles Gründe, die gegen einen Umzug gerade bei diesem Personenkreis sprechen. Und wir erleben auch Menschen, die dann bewusst entscheiden: Dann bleibe ich in meiner Wohnung und nehme in Kauf, dass ich nicht mehr runterkomme. Es geht dann darum, wie organisiere ich zum Beispiel den Arztbesuch mit Hilfe der Krankenbeförderung? Wir haben dann auch die Möglichkeit, noch mal konkret über Hilfsmittel zu sprechen, wie eben Treppensteiger, um darüber die Wohnung zu verlassen, oder auch über Angebote zu sprechen, die es Menschen ermöglichen, trotzdem noch Gemeinschaft zu erleben, über Telefonfreundschaften, Besuchsdienste, also zugehende Angebote, die zumindest ein gewisses Maß an Teilhabe noch ermöglichen.
Claudia Mattheis:Das setzt natürlich voraus, dass diese älteren Menschen auch wissen, dass es sie gibt. Da glaube ich, da kann man noch ein bisschen nachhelfen. Beziehungsweise nicht nur die Leute sollten wissen, dass es sie gibt, sondern auch die Nachbarinnen, die Vermieterinnen und Freunde, Angehörige, eigentlich sollten alle wissen, dass es sie gibt, mit wachem Blick auch mal in der Nachbarschaft zu gucken, ob da vielleicht jemand ist, der Unterstützung brauchen kann, wo man gegebenenfalls auch darauf hinweisen kann. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche den Fall gehabt, mein Vater war im Krankenhaus und im Nachbarbett lag ein älterer Herr nach einer Hüft-OP und ohne Lebensmut. Und seine Angehörigen redeten auf ihn ein und die wussten aber auch gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll, wie er jetzt Hilfe bekommt, er konnte nicht mehr alleine zu Hause wohnen. Die wussten gar nicht, dass es so etwas gibt wie Pflegestützpunkte. Herr Lange, was können wir da tun?
Christian Lange:Ja, ich sage mal, ein bisschen zweigeteilt. Insgesamt glaube ich, in der Medienberichterstattung spielt Pflege momentan eine relativ große Rolle in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Das hat allerdings weniger damit zu tun, dass man das Thema positiv besetzt, sondern es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es durch die Finanzierungsprobleme in der Pflegeversicherung, durch fehlende Pflegeheimplätze, durch fehlende Pflegekräfte einen negativen Anstrich hat, sozusagen. Und dadurch aber viel in den Medien Verbreitung findet. Ich habe so das Gefühl, dass aber doch schon Menschen erreicht werden und die ein bisschen früher für das Thema aufgeschlossen werden. Andererseits sprechen wir hier natürlich auch über eine Zielgruppe, die, sagen wir mal, mit der Medienarbeit eingeschränkt erreichbar ist. Also wir gehen deswegen als Pflegestützpunkte auch ganz viel dorthin, wo die Menschen sind. Wir sind auf vielen Infoveranstaltungen und Messen, wir sind in den Kiezen unterwegs, wir halten Vorträge in Gemeinden, in Stadtbüchereien, in ähnlichen Institutionen oder Partnerorganisationen, wo die Menschen hinkommen. Und trotzdem wird es uns, Ihnen genauso wie mir, so gehen, dass man auch im Bekanntenkreis Menschen hat, die pflegende Angehörige sind und die sagen: Keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Pflegestützpunkt, noch nie von gehört. Und dabei gibt es auch immer wieder die Erfahrung des Verdrängens. Wir hatten das am Anfang des Gesprächs, es begegnet einem dann doch immer wieder. Dieses: Damit beschäftige ich mich, wenn es so weit ist. Das ist bei meinen eigenen Eltern auch so. Es ist ein ganz, ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss, bis man da mal kleine Schritte vorwärts kommt. Aber wir sind schon Schritte vorwärts gekommen.
Claudia Mattheis:Naja, das tangiert ja so viele Aspekte. Das ist Trauer, Angst, also Verlust der eigenen Mobilität, dann vielleicht auch ein bisschen der eigenen Identität, weil man nicht mehr so leben kann, wie man es bisher gewohnt war. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Aber es hilft ja nichts, das zu verdrängen. Aber es gibt Unterstützung, dieses dichte Netz an Pflegestützpunkten, das hat mich wirklich überrascht, dass wir hier in Berlin so gut aufgestellt sind. Man glaubt ja gemeinhin nicht, dass Berlin so etwas so gut organisiert bekommt, aber da sind wir ja doch relativ weit vorne. Aber das bedeutet auch, dass wenn ich sehen würde, dass eine Nachbarin von mir Probleme hat und nicht mehr gut die Treppe hochkommt, ich ihr empfehlen kann, dass sie sich mit Ihnen austauscht und sie dann Beratung bei Ihnen findet.
Andrea Didszun:Unbedingt, Frau Mattheis, ist tatsächlich was, das erleben wir gar nicht selten, dass aus der Nachbarschaft eine Meldung kommt, wo gesagt wird: Ich habe dies und jenes beobachtet. Und wir dann sagen: Sprechen Sie bitte Ihren Nachbarn, Ihre Nachbarin an, sie kann sich jederzeit melden. Oder wenn die Nachbarin einverstanden ist, können Sie auch uns Bescheid geben, dass wir uns melden können. Immer eben sozusagen das Einverständnis vorausgesetzt, das ist klar, wir melden uns bei niemandem, der es nicht möchte. Das ist bei uns in der Beratung immer einvernehmlich. Aber das ist ganz wichtig. Und was wir uns wünschen, ist eben noch mehr auch aus der professionellen Landschaft, wenn ich zum Beispiel an die Arztpraxen denke, wenn ich an die Apotheken denke, also die Anlaufstellen, wo auch Menschen, die sonst ganz schwer erreichbar sind, die sonst vielleicht auch überhaupt keine sozialen Bezüge mehr haben, doch noch mal anlaufen, dass also diese Partner das im Blick haben und verweisen könnten auf unsere Anlaufstellen. Und ganz richtig, Berlin ist aus meiner Sicht ausgesprochen gut aufgestellt, wenn wir uns das Pflegeunterstützungssystem angucken. Nicht nur wir Berliner Pflegestützpunkte, sondern auch die Angebote für pflegende Angehörige im Bereich Entlastung, auch spezielle Beratungsangebote zum Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Gewalt und Konflikte in der Pflege. Also da gibt es wirklich viel und es wäre natürlich schön, wenn die Menschen in Berlin das auch kennen und gerne nutzen. Wir sind für die Menschen da.
Claudia Mattheis:Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort, ist es aber noch nicht so ganz, weil jetzt kommt meine Lieblingsfrage zum Ende, wie immer im LIVVING Podcast: Wie möchten Sie selbst in Zukunft leben und wohnen, wo Sie doch jeden Tag so viel damit zu tun haben?
Andrea Didszun:Tatsächlich habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs relativ lange darüber nachgedacht, was ich sage. Eigentlich träume ich davon, ich komme von der See, dann auch wieder an der See zu leben, in einem Bungalow, alles ebenerdig, barrierefrei, mit Blick aufs Wasser. Das wäre so mein Traum. Aber eigentlich wäre es unklug, das zu machen, weil ich habe hier an meinem Wohnort meine sozialen Bezüge, meine Freundschaften, meine Nachbarschaft und alles, was ich brauche an Infrastruktur. Daher wünsche ich mir tatsächlich, in gewachsenen Bezügen mit Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin, zu leben und optimalerweise dann eben auch in einer Wohnung, die nicht im dritten Obergeschoss im Altbau liegt, wie jetzt, und besser geeignet ist. Aber das ergibt sich dann.
Claudia Mattheis:Also ich fasse zusammen: Bungalow in zentraler Berliner Lage mit Meerblick. Ja, gut, ich nehme dann das Nachbargrundstück. Ich bin dabei. Herr Lange, und Sie? Ziehen Sie auch dahin?
Andrea Didszun:Ja, perfekt, das würde mir gut gefallen.
Christian Lange:Es ist für uns alle, glaube ich, total schwierig, sich selbst als alten Menschen vorzustellen. Wie geht es mir körperlich und geistig in 20 oder 30 Jahren? Wer ist in der Lage, sich das überhaupt auszumalen? Eine ganz schwierige Frage. Und wenn ich mich selbst als alten Menschen vor mir sehe, sagen wir mal den über 80-Jährigen, dann würde ich beinahe sagen: am liebsten gesund sterben. Also die Vorstellung ist eigentlich schon eher die, dass ich gerne dort wohnen möchte, wo ich wohne, dass ich nicht in ein Pflegeheim umziehen muss oder ein ähnliches Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen möchte. Das ist jetzt so ein bisschen kontraproduktiv beinahe. Über den Ort habe ich jetzt gar nicht so sehr nachgedacht. Meine Mutter dagegen denkt zum Beispiel über einen Umzug in ein Pflegeheim nach, das würde sie gerne machen, weil sie dort soziale Kontakte knüpfen kann und da gibt es doch so einen Tagungsraum und da kann man sich doch mit anderen Menschen austauschen. Da freut die sich schon beinahe drauf.
Claudia Mattheis:Ist doch toll.
Christian Lange:Ja, das ist super, das finde ich sehr toll. Für mich persönlich wäre das nicht so unbedingt geeignet.
Claudia Mattheis:Aber natürlich, wenn Sie, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, in der eigenen Wohnung weiter wohnen können und diese dann auch zu Ihrem jeweiligen Mobilitätsbedarf passt und Sie Unterstützung hätten, wenn Sie sie brauchen, und kurze Wege, sodass man alles von Arzt bis Einkaufen und Unterhaltung, alles drum herum hat, und Freunde.
Christian Lange:So ungefähr stelle ich mir das vor, so bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die man sich da wünscht.
Claudia Mattheis:Ja, die suchen wir alle. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch und hoffe, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass die Arbeit von Ihnen in den Pflegestützpunkten bekannter wird. Und ich werde es auf jeden Fall überall rumerzählen, wenn ich davon höre, dass jemand Unterstützung braucht, dass es Sie gibt. Vielen Dank für das Gespräch.
Christian Lange:Gerne, danke für die Einladung.
Andrea Didszun:Herzlichen Dank.
Service-Wohnen: Selbstständig leben und gleichzeitig gut versorgt sein
Interview mit Birgit Welslau: Welche Wohnform passt zu mir im Alter?
Interview: Vom Bürogebäude zur Senioren-WG. Ein Wohnmodell für die Zukunft?
Interview mit Birgit Danschke: Wie funktioniert gemeinsames Wohnen im Alter?
Pflege-WG auf dem Bauernhof: Pflegebauernhof bietet Wohnen im Grünen mit Familienanschluss