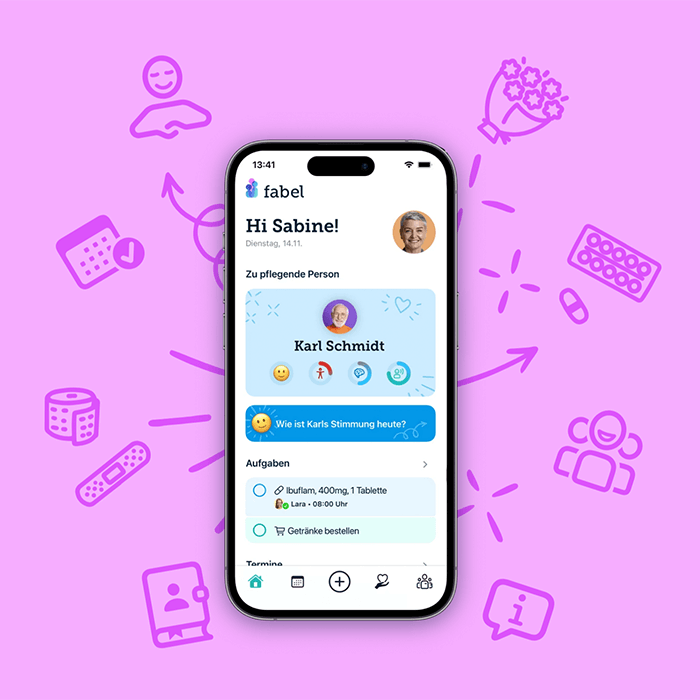Architektur als „Betriebssystem“ für soziales Miteinander: Wie ein Berliner Architekt das Wohnen im Alter revolutionieren will
Die Boomer-Generation steht vor einem Problem: Das aktuelle Pflegesystem wird ihre Bedürfnisse nicht erfüllen können. Während die Politik noch über längere Arbeitszeiten diskutiert, denkt Architekt Jörn Pötting bereits konkrete Alternativen aus. Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Bauen für Senioren und hat eine klare Vision: Co-Housing-Projekte, die individuelle Freiheit mit gemeinschaftlichen Räumen kombinieren.
Als Generalplaner deckt Pötting ein breites Spektrum ab: vom Bau für Senioren über nachhaltigen Geschosswohnungsbau bis hin zu Quartierskonzepten. Für ihn ist Architektur mehr als funktionale Räume – sie ist ein „Betriebssystem für soziales Miteinander“, das Gemeinschaft stärkt und Lebensqualität fördert. Seine These: Das Leben im Alter muss für die Boomer-Generation radikal neu gedacht werden.
Im Gespräch mit Claudia Mattheis erklärt der 1963 geborene Architekt, warum seine Generation Teil des Problems ist, wie Co-Housing konkret funktioniert und warum er von Kommunen, Kirchen und Investoren mehr Mut fordert.
Die wichtigsten 5 Erkenntnisse aus dem Interview
- Das System fährt gegen die Wand: Immer mehr Rentner werden von immer weniger Erwerbstätigen finanziert; das aktuelle Pflegemodell ist nicht zukunftsfähig.
- Boomer sind Individualisten: Die Generation, die gerade in Rente geht, hat völlig andere Ansprüche als die Kriegskinder, die heute in Altersheimen leben.
- Co-Housing reduziert Pflegebedarf: Gemeinschaftliches Wohnen verschiebt den Eintritt in schwere Pflegebedürftigkeit deutlich nach hinten.
- Pragmatische Lösungen sind möglich: Von umgebauten Bürogebäuden bis zu Genossenschaftsprojekten – es gibt bereits umsetzbare Modelle.
- Eigenverantwortung ist gefragt: Die Boomer-Generation muss sich aktiv mit dem Altwerden auseinandersetzen, statt darauf zu vertrauen, dass andere Lösungen bereitstellen.

Warum wir Jörn Pötting eingeladen haben
Weil er als Praktiker täglich sieht, was im Pflegesystem schiefläuft. Weil er konkrete Alternativen entwickelt, statt nur Probleme zu benennen. Und weil er seiner eigenen Generation unbequeme Wahrheiten zumutet: „Ob uns das eigentlich bewusst ist, dass wir eigentlich das Problem sind?“
Die Boomer-Generation: Individualisten ohne Plan
Warum das aktuelle System nicht funktioniert
Jörn Pötting gehört selbst zur Boomer-Generation und sieht die Herausforderung klar: „Wir kommen in eine Zeit, in der immer mehr Rentner von immer weniger Erwerbstätigen finanziert werden.“ Seine Analyse ist nüchtern: „So wie es jetzt organisiert ist, wird es auf keinen Fall weiter zu finanzieren sein. Das wissen im Prinzip alle. Aber keiner will es so richtig aussprechen.“
Der Unterschied zu heute
„Wir haben im Augenblick die Kriegskinder, die in den Altersheimen sind, die den Krieg als Kinder erlebt haben, die sehr leistungsorientiert sind und sich sehr gut bescheiden können. Und da ist unsere Generation wirklich weit entfernt. Wir sind eine Generation von Individualisten, die ganz andere Ansprüche hat.“
Co-Housing: Was Gemeinschaftswohnen konkret bedeutet
Eigene Wohnung plus Gemeinschaftsräume
„Co-Housing ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff“, räumt Pötting ein. „Eigentlich ist es eher ein kollaborierendes Wohnen, ein Gemeinschaftswohnen mit individuellem Anspruch.“ Das Konzept ist klar strukturiert: „Jeder hat seine eigene Wohnung. Was interessant und wichtig ist, weil wir auch aus einer Generation kommen, die Wohngemeinschaftserfahrung hat oder hatte und wir auch nicht dahin zurückkommen möchten.“
Zusätzlich gibt es „Gemeinschaftsflächen, angefangen bei einer gemeinschaftlichen Küche, Werkräumen, Bibliotheksräumen, Handwerksräumen wie Nähmaschinenräumen, Töpferräumen – also alles, was man sich vorstellen kann, die von der Miete oder von den Mietern gemeinschaftlich finanziert werden, aber selbstverwaltet organisiert werden, etwa in einer AG-Struktur.“


Beispiel aus Dänemark: Ein erfolgreiches Co-Housing-Projekt
Ein konkretes Beispiel liefert ein dänisches Co-Housing-Projekt: „Es ist eine dörfliche Struktur mit Häusern, die jeweils drei Wohnungen haben, ungefähr 60 Wohnungen. Und die haben eine Gemeinschaftsküche, und dort kann jeder, der will, mitmachen. Man zahlt drei Euro pro Essen und hat dann warmes Essen pro Tag, verpflichtet sich allerdings auch, für diese Gemeinschaftsküche zu kochen.“
Das System basiert auf Freiwilligkeit und Rotation: „Man kocht nicht alleine, sondern in einer Gruppe, trägt sich in eine Liste ein, und in einem rotierenden System von circa einer Woche oder zehn Tagen ist jede Gruppe mal dran zu kochen.“ Wichtig: „Wer das aber nicht machen möchte, muss es nicht tun.“
Vom Rockfan zum Co-Housing-Interessenten: Wie Vorurteile durch konkrete Visionen entkräftet werden können
Pötting erzählt eine aufschlussreiche Anekdote über einen 70-jährigen Cousin: „Der wohnt im dritten Stock in Karlsruhe und hat eine Plattensammlung. Ist so ein Liebhaber der Rockmusik. Zehntausend Platten. Schlagzeuger, ein richtig guter Schlagzeuger, bekannt im süddeutschen Raum. Und der meinte: ‚Ich ziehe nie aus meiner Wohnung aus.‘“
Doch als Pötting konkret wurde, änderte sich die Einstellung: „Und dann habe ich gefragt: ‚Was meinst du, wenn du zum Beispiel in einer Wohnung wohnen würdest, in der du einen Aufzug hast, eine eigene Wohnung, die vielleicht jetzt nicht so groß ist wie deine, ein bisschen kleiner, aber du hast einen Gemeinschaftsraum wie eine Bibliothek, und da wohnt in dem Haus vielleicht noch jemand, der auch Rockmusikplatten hat, und mit dem machst du Musik?‘“ Das Ergebnis: „Und da guckte er mich plötzlich an und meinte: ‚Aha, sowas? Da würde ich hingehen.‘“

Die Finanzierung:
Von Genossenschaften bis zu Mischkonzepten
Bezahlbarkeit durch effiziente Grundrisse
„Bezahlbarkeit kann man dadurch erreichen, dass die Wohnungen effizient geschnitten sind“, erklärt Pötting. „Unsere Erfahrung ist, dass die Mischung bei 35, 45, 55 Quadratmetern für zwei Personen und 75 Quadratmetern für zwei Personen – noch mit einem Arbeitszimmer oder einem Gästezimmer – die Wohnungsgrößen sind, die interessant sind.“
Das Eisenhüttenstädter Modell
Ein konkretes Beispiel entwickelt Pötting in Eisenhüttenstadt: „Wir haben ein interessantes Projekt in Eisenhüttenstadt mit der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft, wo wir genau so etwas probieren. Das Spannende ist, dass es eine Genossenschaft ist und das Projekt mit Genossenschaftsanteilen finanziert werden soll.“
Was sich ändern muss: Ein Appell an alle Beteiligten
An die Kommunen
„Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinden das sehen und Flächen dafür zur Verfügung stellen“, fordert Pötting. „Wir haben die Möglichkeit, aktiv Senioren anzuziehen – aus großen Wohnungen, aus Eigenheimen –, damit diese Immobilien dann wieder von Jüngeren genutzt werden können.“
An die eigene Generation
Sein Appell ist eindringlich: „Ich würde auch an uns appellieren, an die Boomer: Beschäftigt euch mit dem Altwerden. Vertraut nicht darauf, dass die Rente reicht. Vertraut nicht darauf, dass die Pflegeplätze reichen. Vertraut nicht darauf, dass irgendwie jemand im Alter euch pflegen kann. Es wird nicht so sein.“
An Investoren und Kirchen
„Dann würde ich mir wünschen, dass Investoren erkennen, dass es eine wirklich interessante Investitionsmöglichkeit ist.“ Auch die Kirchen sieht er in der Pflicht: „Die Kirchen, die über erhebliche Flächenreserven in Deutschland verfügen, sollten erkennen, dass das ein gesellschaftliches Thema ist.“
Persönliche Vision: Gemeinschaft nach Wahl
Wie Pötting selbst leben möchte
Auf die Frage nach seinen eigenen Plänen antwortet der Architekt: „Ich möchte gerne spannende Sachen erleben. Ich möchte gerne kreativ sein. Ich möchte gerne im Austausch mit anderen Menschen interessante Gespräche haben. Ich würde ungern allein wohnen. Ich will aber auch meine eigene Wohnung haben.“
Seine Idee: „Die Idee zum Beispiel, mit anderen Kollegen ein kleines Atelier zu haben, wo wir Architekturmodelle bauen, zusammen Musik machen oder kleine Lesungen veranstalten können. Das finde ich viel interessanter, als in einer Wohnung oder in einem Wochenendhaus in Mecklenburg-Vorpommern zu sein.“
Warum Sie dieses Podcast-Interview hören sollten
Weil Jörn Pötting unbequeme Wahrheiten ausspricht und gleichzeitig konkrete Lösungen aufzeigt. Weil er beweist, dass die Boomer-Generation ihre Erfahrung als Macher nutzen kann, um das Altersproblem selbst zu lösen. Und weil er zeigt, wie Architektur gesellschaftliche Herausforderungen meistern kann.
Seine Botschaft ist klar: „Wir sind eine Generation, die eigentlich sehr undogmatisch an viele Themen herangehen kann und es gewohnt ist, pragmatische Lösungen zu schaffen. In unserer Jugend haben wir Kinderläden aufgebaut, als es keine gab. Wir haben Gründungen vorangetrieben, wir haben grüne Parteien gegründet, wir haben Windräder aufgestellt, als noch niemand dachte, dass es überhaupt geht.“
Wer verstehen will, wie Wohnen im Alter jenseits von Altersheimen aussehen kann, sollte dieses Gespräch nicht verpassen.
Weitere Informationen zu Jörn Pöttings Projekten und Co-Housing-Konzepten finden Sie auf seiner Website.
Weitere Informationen finden Sie hier:
LinkedIn: Jörn Pötting
Webseite: www.poetting-architekten.de

Jetzt LIVVING Podcast anhören!
Zum Beispiel mit einem kostenlosen Account bei Spotify:
Kein Account? Kein Problem!
• Sie können alle Podcast-Folgen auch direkt hier auf unserer Webseite anhören
• Klicken Sie dazu einfach rechts im Kasten auf “Inhalt entsperren” und dann auf den Abspielpfeil
• Sie finden uns auch auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.
• Und natürlich gibt es den LIVVING Podcast auf YouTube
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Lieber lesen, als Podcast hören? Interview zum Nachlesen!
Interview mit Jörn Pötting:
Ist Co-Housing im Alter eine Lösung für die Pflegekrise?
Claudia Mattheis:
Hallo, herzlich willkommen in meinem LIVVING Podcast Studio, lieber Jörn Pötting. Warum ich dich eingeladen habe? Weil du als Architekt und Generalplaner eine klare Vision hast: wie Wohnen im Alter neu gedacht und sozial gestaltet werden kann. Seit deinem Studium beschäftigst du dich konsequent mit der Frage, was wirklich gutes Wohnen im Alter ausmacht. Mit deinen Projekten deckst du ein breites Spektrum ab: vom Bau für Senioren – also stationäre Pflege, betreutes Wohnen, Tagespflege und Quartierskonzepte – bis hin zu nachhaltigem Geschosswohnungsbau. Dieser umfasst Eigentums- und Mietwohnungen genauso wie sozialen Wohnungsbau.
Für dich bedeutet Architektur nicht bloß funktionale Räume. Du siehst sie als ein Betriebssystem für soziales Miteinander, als Orte, die Gemeinschaft stärken und Lebensqualität fördern. Du sagst deutlich, dass das Leben im Alter für die Boomer-Generation radikal anders gedacht werden muss. Nicht Pflege und Versorgung allein stehen im Mittelpunkt, sondern gelebte Nachbarschaft, Gemeinschaft und Teilhabe. Besonders spannend finde ich deine Arbeit rund um Co-Housing-Projekte, bei denen individuelle Freiheit mit gemeinschaftlichen Räumen kombiniert wird. Genau über diese neuen Wohnformen möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo Jörn, jetzt darfst du auch was sagen.
Jörn Pötting:
Ja, hallo Claudia, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch fleißig deine Podcasts gehört – sehr toll, sehr spannend. Ich freue mich und fühle mich geehrt, dass ich dabei sein darf.
Claudia Mattheis:
Und dieses Lob qualifiziert dich jetzt für die erste Frage.
Jörn Pötting:
Danke. Das Thema Boomer-Generation ist ja sehr spannend. Ich selbst gehöre dazu, Jahrgang 1963, also mittendrin. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Thema Bauen für Senioren, aber auch mit Geschosswohnungsbau. Wir fühlen uns so in der Mitte zwischen Wohnungswirtschaft und Pflegewirtschaft, auch beim Thema stationäre Pflege, also das klassische Altersheim. Das macht Spaß, das zu entwerfen und zu bauen.
Aber wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, fragt man sich: Wie lange geht das noch gut mit unserem System? Wir planen und setzen stationäre Pflegekonzepte um – Altersheime, die je nach Ausführung und Bauherr mal richtig gut gemacht werden dürfen und mal eher Standard folgen. Wir haben zum Beispiel für die Jura-Nita-Unfallhilfe vor inzwischen elf Jahren an der Havel in Potsdam das Johanniter-Quartier gebaut: auf 10.000 Quadratmetern, 62 Wohnungen mit Schwimmbad und allem drum und dran. Dann haben wir auch in Schleswig-Holstein stationäre Pflege gebaut.
Aber wenn man sich unsere Generation ansieht und fragt, wie es weitergeht, dann fragt man sich: Ist das wirklich das Konzept, dass wir immer mehr stationäre Heime bauen? Ich glaube nicht. Und ich frage mich auch, wie unsere Generation – die jetzt in Rente kommt – über ihre eigene Rolle nachdenkt. Ob uns eigentlich bewusst ist, dass wir das Problem sind.
Claudia Mattheis:
Damit hast du schon, ohne dass ich sie gestellt habe, meine erste Frage beantwortet. Das können wir so beibehalten. Aber vielleicht stelle ich trotzdem die Fragen erst und du antwortest dann. Meine erste Frage wäre gewesen: Warum muss das Wohnen im Alter für die Boomer neu gedacht werden? Du hast schon Teilantworten gegeben, aber warum muss es neu gedacht werden? Weil wir andere Ansprüche stellen?
Jörn Pötting:
Ja, man muss es klar sagen. In der Politik wird das ja langsam lanciert, dass wir Älteren länger arbeiten müssten. Hintergrund ist, dass das Sozialsystem komplett gegen die Wand fährt. Die Rente wird schon jetzt massiv finanziert. Wir kommen in eine Zeit, in der immer mehr Rentner von immer weniger Erwerbstätigen finanziert werden müssen.
Auf der einen Seite steht unsere Generation und sagt: Wir brauchen Pflege, wir brauchen dies und das. Aber ich stelle mir die Frage: Wir sind eine Gemeinschaft, ein Staat. Und der Staat, das sind wir. Er kann nur das ausgeben, was irgendwo wieder eingenommen wird. Man muss sich Gedanken machen, wie das Ganze zu finanzieren ist. Wenn wir alle in Rente gehen, ist eines klar: So kann es nicht weitergehen. So, wie es jetzt organisiert ist, wird es auf keinen Fall weiter zu finanzieren sein. Das wissen im Prinzip alle. Aber keiner will es so richtig aussprechen.
Claudia Mattheis:
Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, über den wir hier bei LIVVING auch immer wieder sprechen. Altersarmut war ein großes Thema in meinem vorletzten Podcast. Aber jetzt mal unabhängig von der Rente, vom gemeinschaftlichen System: Was bedeutet Wohnen im Alter für jeden Einzelnen?
Die Generationen der Menschen, die jetzt demnächst in Rente gehen, sind anders sozialisiert und aufgewachsen als die Seniorinnen-Generationen vorher. Merkst du, dass es da eine andere Anspruchshaltung gibt, wie das Wohnen im Alter aussehen soll? Denken Leute, die so alt sind wie du und ich, jemals daran, in ein Altersheim oder Pflegeheim zu gehen?
Jörn Pötting:
Ganz bestimmt nicht. Unsere Generation denkt eher über den nächsten Urlaub möglichst weit weg nach, vielleicht auch im eigenen Land, die nächste Kreuzfahrt, vielleicht auch die nächste Ausbildung. Ich sage mal: Wir denken eher darüber nach, surfen zu lernen, Fallschirmspringen zu lernen, alles andere zu machen. Aber eigentlich sollten wir uns ab und zu mal darüber Gedanken machen, Pflege zu lernen – vielleicht auch. Und wie wir wohnen wollen, ist spannend.
Ich glaube, unsere Generation hat wirklich radikal andere Vorstellungen als die Generation, die jetzt in den Altersheimen ist. Wir haben im Moment die Kriegskinder in den Altersheimen, die den Krieg als Kinder erlebt haben, die sehr leistungsorientiert sind und sich sehr gut bescheiden können.
Und da ist unsere Generation wirklich weit entfernt. Wir sind eine Generation von Individualisten, die ganz andere Ansprüche an Persönlichkeit haben. Wenn wir älter sind, gibt es dafür aktuell noch keine richtigen Wohn- und Betreuungsformen. Und meine These ist: Wir müssen uns überlegen, wie wir das gut machen können. Es gibt interessante Beispiele aus Skandinavien. Aber es sind Wohnformen vorstellbar im Ausland, die wir Boomer uns noch gar nicht richtig vorstellen können.
Claudia Mattheis:
Hier in Deutschland. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum wir mit LIVVING gestartet sind: möglichst viele Wohnoptionen aufzuzeigen und auch die Handlungsmöglichkeiten, die man hat – oder darauf hinzuweisen, dass man sie vielleicht ab einem bestimmten Alter nicht mehr unbedingt hat.
Du hast in unserem Vorgespräch diesen schönen Satz geprägt: „Architektur ist ein Betriebssystem für soziales Miteinander.“ Das fand ich sehr schön. Vielleicht steckt da auch ein bisschen die Lösung des Wohnproblems drin. Was genau meinst du damit?
Jörn Pötting:
Es gibt verschiedene Arten, an Architektur heranzugehen. Natürlich sind gute Gestaltung und gute Proportionen wichtige Themen, genauso wie die technische Seite. Mich interessiert oft das Konzept. Meine These ist: Architekturkonzepte können interessante Antworten auf gesellschaftliche Fragen geben.
Das klingt ein bisschen akademisch, aber ich glaube wirklich: Wenn man sich überlegt, wie man etwas organisieren möchte, und das gut durchdenkt, kann man damit viele Probleme lösen. Das ist auch eine Stärke des Architektenberufs. Gerade beim Wohnen fürs Alter steckt da noch viel drin, was ich mir vorstellen kann – aber viele von uns können es sich noch gar nicht vorstellen.
Ich habe zum Beispiel einen Cousin meiner Frau, 70 Jahre alt. Wir hatten eine Familienfeier und ich habe ihm von meinen Co-Living-Projekten erzählt. Er sagte: „Ich ziehe aus meiner Wohnung nie aus.“ Er wohnt im dritten Stock in Karlsruhe, hat eine Plattensammlung, ist ein Liebhaber der Rockmusik, Schlagzeuger, bekannt im süddeutschen Raum. Und er meinte: „Ich fühle mich da so wohl.“
Da habe ich mich gefragt: Stelle ich mir die richtige Frage? Und dann habe ich gefragt: „Was meinst du, wenn du in einer Wohnung wohnen würdest, die einen Aufzug hat? Eine eigene Wohnung, vielleicht nicht so groß wie deine, aber mit einem Gemeinschaftsraum wie eine Bibliothek? Und in dem Haus wohnen vielleicht andere, die auch Rockmusikplatten haben und mit denen du eine Bibliothek machst? Die sind genauso akribisch wie du und polieren diese Sachen und so… und vielleicht hast du auch einen Proberaum, wo du Schlagzeug spielen kannst. Und vielleicht ist da noch ein Bassist bei dir im Haus.“ Und da guckt der mich an und sagt: „Also so etwas? Da würde ich hingehen.“ Da dachte ich mir: Ja, siehst du!
Das sind Beispiele, bei denen sich unsere Generation noch gar keine Gedanken gemacht hat, wie man eigentlich zusammenleben könnte. Und das Interessante ist: Wir sind eine Generation, die sehr undogmatisch an viele Themen herangehen kann und es gewohnt ist, pragmatische Lösungen zu schaffen. In unserer Jugend haben wir Kinderläden aufgebaut, als es keine gab. Wir haben grüne Parteien gegründet, Windräder aufgestellt, als noch niemand dachte, dass es überhaupt geht. Wir sind eine Generation, die einfach macht.
Claudia Mattheis:
Wir haben den Punk erfunden.
Jörn Pötting:
Punk, genau. Also wir haben die 68er mit ihren theoretischen Debatten und marxistischen Abspaltungen – und alle haben gesagt: Wir machen jetzt einfach mal was, auch wenn wir keine Instrumente spielen können. Punk ist eine interessante Sache. Ich liebe dieses Buch von Heinz Bude, „Abschied von den Boomern“. Das fängt mit dem Text von den Talking Heads an: „Stop Making Sense“. Das finde ich eine sehr gute Überschrift für unsere Generation: Aufhören mit dem Theoretisieren, anfangen mit dem Machen. Wir sind Macher.
Claudia Mattheis:
Und konkreter werden. Genau, und deswegen jetzt auch wieder, damit wir wieder ein bisschen konkreter werden: Du hattest am Beispiel deines Cousins sehr schön beschrieben, was Co-Housing sein kann. Co-Housing ist aber auch so ein Wort, das für viele wahrscheinlich noch gar nicht so richtig präsent ist. Beschreib das mal. Was ist Co-Housing ganz konkret?
Jörn Pötting:
Co-Housing ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, weil er in der Immobilienwirtschaft für andere Themen genutzt wird. Eigentlich ist es eher ein kollaborierendes Wohnen, ein Gemeinschaftswohnen mit individuellem Anspruch. Das bedeutet: Jeder kann in seiner eigenen Wohnung wohnen. Jeder hat seine eigene Wohnung – was wichtig ist, weil wir aus einer Generation kommen, die Wohngemeinschaftserfahrung hat oder hatte. Aber wir möchten nicht dahin zurück.
Jeder, mit dem ich spreche, sagt: Das möchten wir nicht nochmal haben – endlose Diskussionen im Plenum über den Kühlschrank. Jeder ist froh, dass er seine eigene Wohnung hat. Und das geht auch. Man kann Wohnungsbauprojekte so machen, dass bezahlbare Wohnungen möglich sind. Das Geheimnis ist, sie in verschiedenen Größen zu bauen.
Aber darüber hinaus gibt es Gemeinschaftsflächen: angefangen bei einer gemeinschaftlichen Küche, Werkräumen, Bibliotheksräumen, Handwerksräumen wie Nähmaschinenräumen, Töpferräumen – was man sich vorstellen kann. Diese werden von den Mietern gemeinschaftlich finanziert, aber selbstverwaltet organisiert, in einer Art AG-Struktur. Das ist ein guter Schlüssel, um beides zu ermöglichen: den individuellen Rückzugsraum, die eigene Wohnung, die für uns alle elementar ist. Aber wir haben die Chance, im Alter gemeinschaftlich zu agieren – über selbst organisierte Tools, sei es das schwarze Brett, eine App oder ein Plenum.
Und das kann man sich zum Beispiel sehr gut in Skandinavien ansehen. Dort gibt es diese Konzepte in verschiedenen Variationen, auch in ländlichen Gebieten.
Claudia Mattheis:
Beschreib mal eins ganz konkret.
Jörn Pötting:
Ganz konkret gibt es zum Beispiel das Balancenprojekt in Rai in Dänemark. Es ist eine dörfliche Struktur mit Häusern, die jeweils drei Wohnungen haben – insgesamt etwa 60 Wohnungen. Und die haben eine Gemeinschaftsküche. Dort kann jeder, der will, mitmachen. Man zahlt drei Euro pro Essen und hat dann ein warmes Essen pro Tag. Man verpflichtet sich allerdings auch, für diese Gemeinschaftsküche zu kochen. Man kocht nicht allein, sondern in einer Gruppe. Man trägt sich in eine Liste ein und in einem rotierenden System ist jede Gruppe mal dran zu kochen. Jeder bekommt sein Essen. Wer nicht mitmachen möchte, muss es nicht. Das ist sehr wichtig, dass es auf Freiwilligkeit basiert.
Darüber hinaus gibt es andere Räume wie Werkstatträume. Interessant ist: Die Werkstätten werden bestückt aus dem Reservoir der dort Wohnenden. Sie stellen ihre Werkzeuge zur Verfügung, die der Gemeinschaft nutzen. Natürlich mit dem Risiko, dass vielleicht das eine oder andere kaputtgeht. Aber sie freuen sich, dass es genutzt wird. Und auch in so einer AG-Struktur gibt es dann Gemeinschaftsprojekte, bei denen man etwas zusammen macht. Oder jeder kann das für ein eigenes Projekt nutzen. Man möchte einen Stuhl bauen oder ein Regal – und kann Nachbarn fragen, die technisch versiert sind.
Es gibt auch Gartenprojekte, ganz einfach, ganz beliebt: Gemeinschaftsbeete. Und in Dänemark ist es obligatorisch, dass jedes Wohnungsbauprojekt oder jedes Hausprojekt dort ein Gewächshaus hat. Aber so dimensioniert, dass das Gewächshaus zwar wie früher Tomatenpflanzen heranziehen kann, aber auch Platz bietet, um sich gemeinsam zu setzen. Also dieses Gewächshaus ist immer etwas größer dimensioniert, als Gemeinschaftsraum. Dort werden dann Themen besprochen, Gartenarbeit gemacht, Pläne geschmiedet. Das sind Projekte, bei denen tatsächlich auch eine gute Altersmischung da ist – von 60 bis 85, ins hochbetagte Alter. Und das funktioniert.
Claudia Mattheis:
Wer konzipiert, plant und finanziert das? Und sind es Eigentums- oder Mietwohnungen?
Jörn Pötting:
Ja, spannende Frage. In Dänemark sind das Mietwohnungen. Das ist eine wichtige Erfahrung: Wenn man diese Co-Housing- oder Gemeinschafts-Mietwohnungen konzipieren will, dann muss es top-down gehen. Senioren aus unserer Generation haben einfach keine Zeit mehr, etwas graswurzelmäßig zu entwickeln. Es gibt außergewöhnliche Projekte mit sehr viel Engagement, aber in der Regel möchten die Leute aus unserer Kohorte – also Senioren, die dann auch älter sind – in Mietobjekte einziehen. Und die werden in Dänemark von Wohnungsbauunternehmen und Fonds errichtet.
Die haben auch einen ganz normalen Miethintergrund. Da wird etwas errichtet, um eine gewisse Rendite zu erwirtschaften. Es wird ein Mietprodukt erstellt, mit der Zielgruppe Senioren. Das finde ich spannend: Dort wird ein Mietprodukt generiert, das eine Gruppe von Menschen wirklich interessiert. Und die sagen: „Ich brauche meine große Wohnung oder mein großes Haus nicht, weil ich da vielleicht auch nicht so viele Nachbarn habe.“
Das Interessante ist, dass mit diesem Co-Housing oder Gemeinschaftsmietwohnen – ein bisschen sperriger Begriff – ein Angebot geschaffen wird, das es auf dem deutschen Markt eigentlich noch gar nicht so gibt. Und ich bin der Meinung, dass viele von den zukünftigen Senioren – also die Boomer und 68er – sehr interessiert sein werden an diesem Angebot.
Claudia Mattheis:
Ich bin absolut davon überzeugt. Das Beispiel deines Cousins hat es ja so wunderbar auf den Punkt gebracht. Das ist eine Antwort, die ich auch immer höre: „Aus meiner Wohnung ziehe ich nicht aus, die ist so toll, die ist da, ich finde ja auch nichts Günstigeres. Die ist vielleicht zu groß, aber umziehen ist jetzt auch irgendwie blöd – auch wenn es immer schwieriger wird, die Treppen hochzukommen, und vielleicht bin ich auch ein bisschen einsam.“ Aber wenn man, so wie du das bei deinem Cousin gemacht hast, wirklich sagt: „Okay, aber es gibt ja vielleicht auch andere soziale Vorteile. Man ist mit Gleichgesinnten zusammen. Man kann sich Sachen teilen, man tut aktiv etwas gegen Einsamkeit und letztendlich kümmert man sich ja auch ein bisschen umeinander.“
Das ist schon, ich glaube, damit würden wir viele ältere Menschen, die in viel zu großen Immobilien wohnen, animieren, umzuziehen und nochmal das Leben neu zu planen. Und letztendlich würde das vielleicht auch dazu führen, dass viel mehr Leute länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden bleiben und nicht in ein sehr teures Pflegeheim müssen.
Ich bin der Meinung, das ist schon ein Wohnprojekt der Zukunft, das du gerade beschrieben hast. Aber wie so oft scheitert es vermutlich an der Bezahlbarkeit – hier in Deutschland – oder am Mut der Investoren. Du hast ja viel mit Bauträgern und Immobilienleuten zu tun. Warum kommt das nicht so in Fluss? Haben die das noch nicht kapiert?
Jörn Pötting:
Das liegt an verschiedenen Themen. Wohnungsbau ist seit einiger Zeit schwierig. Für den Wohnungsneubau braucht man einfach einen Mietpreis, der so bei 14 Euro anfängt, von 14 bis 20 Euro. Günstiger können wir einfach nicht bauen, weil die Baupreise und die Finanzierung des Baus – auch durch die gestiegenen Zinsen seit der Covid-Krise und dem Ukrainekrieg – so hoch sind.
Ich glaube aber, dass wir inzwischen in eine Zeit kommen, in der das attraktiv sein könnte. Man muss ein bisschen gucken, wie man das aufsetzt, da kann es verschiedene Modelle geben. Bezahlbarkeit kann man dadurch erreichen, dass die Wohnungen effizient geschnitten sind. Wir haben zum Beispiel für die AWO Spandau vor acht Jahren einen Neubau für Senioren errichtet, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Dort haben wir Appartments angefangen von 35 Quadratmetern mit Balkonen konzipiert, die komplett barrierefrei sind – also für Rollatoren geeignet. Die haben wir dann für 35 Quadratmeter Mietfläche geplant. Und da kann man dann auch mit einem Mietpreis von 15 Euro so rechnen, dass es bezahlbar ist, auch für Sozialhilfempfänger oder für Senioren.
Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, in der viele Senioren von Altersarmut betroffen sind. Das ist ein großes Thema. Wir müssen nur gucken, dass wir als Gesellschaft Wohnraum schaffen, in dem man gut leben kann. Man kann auch in kleinen Wohnungen gut leben. Das Wichtige ist, das Umfeld so zu organisieren, dass man gute Nachbarn hat, dass man im guten Austausch ist und dass man vielleicht auch Nachbarn oder Freunde hat, die im Umfeld – am besten auch in dem Haus – wohnen.
Und das Kann man natürlich dann skalieren. Nicht jeder möchte in eine 35-Quadratmeter-Wohnung und manche können sich vielleicht auch mehr leisten. Unsere Erfahrung ist, dass die Mischung funktioniert. Von 35 über 45 Quadratmeter, 55 für zwei Personen bis zu 75 Quadratmeter, wenn noch ein Arbeits- oder Gästezimmer dazu kommt. Das sind die Wohnungsgrößen, die interessant sind.
Und es gibt eben auch viele Senioren, oder jedenfalls einige, die über eine bessere Pension verfügen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man Projekte aufsetzt, in denen intern etwas subventioniert wird, dann kann das auch funktionieren. Indem die größeren Wohneinheiten ein bisschen teurer sind, damit man die kleinen etwas günstiger machen kann; wenn man das entsprechend kommuniziert, kann das gehen.
Claudia Mattheis:
Und dann kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass Menschen freiwillig in eine kleinere Wohnung ziehen, wenn es dafür als Ausgleich so etwas wie Gemeinschaftsflächen gibt. Das hattest du ja vorhin auch angesprochen. Und wie müssten diese Gemeinschaftsflächen attraktiv und gleichzeitig individuell nutzbar gestaltet werden? Was sind da die Herausforderungen?
Jörn Pötting:
Das ist spannend. Ich glaube, bei jedem Projekt gibt es Punkte, bei denen man relativ günstig Gemeinschaftsthemen finden kann. Am besten sind zum Beispiel Freiflächen, die man als Gemeinschaftsgarten nutzen kann. Dann gibt es das Gewächshaus, in dem man sitzen kann und umliegend Gartenarbeit machen kann. Das geht super. Oder Freiflächen, auf denen man etwas machen kann.
Wir haben ein Projekt in Frankfurt, bei dem wir auf dem Dach eine Dachsauna gebaut haben – was jetzt für die Kosten nicht so teuer ist, aber ein Hit war. Man konnte auf den Taunus gucken und musste natürlich darauf achten, dass die Sauna so ein bisschen umschlossen ist, dass niemand von oben reingucken kann. Aber das haben alle geliebt und es war gar nicht so teuer.
nd dann kann man das deklinieren: Wenn man einen Neubau hat, ist es natürlich toll, dass man Foyers und Flächen so nutzt, dass man dort aktiv etwas machen kann – bis dahin, dass man Räume hat, die man wirklich gemeinschaftlich nutzen kann, die man flexibel nutzen kann als Werkraum oder als Yogaraum. Da gibt es tolle Beispiele, bei denen das möglich ist.
Claudia Mattheis:
Neubau ist ja immer teuer – und vor allem neue Grundstücke zu finden, auf denen man auch bauen kann und darf. Das, was du jetzt angesprochen hast, wäre ja vielleicht auch machbar in bereits bestehenden Immobilien, die dann umgewidmet werden. Sei es ein Bürogebäude oder – was ich neulich gelesen habe – ein Hotel, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist, idyllisch am See gelegen. Die Betreiber sagen: „Das war die letzte Saison, ab nächstes Jahr vermieten wir das wirklich an Menschen, die fest dort wohnen wollen – an Menschen 60 plus.“ Denn alle Zimmer haben ja bereits ein Bad, sind teilweise auch barrierearm. Und dann werden die Gemeinschaftsflächen genutzt. Das fand ich eine charmante Idee. Und dann natürlich diese unendlich vielen Büroflächen, die es so gibt – oder diese ganz flachen Dächer von Parkhäusern oder Supermärkten. Könnte man da nicht auch irgendwie ein kleines Senioren-Dorf draufpacken? Wie siehst du das als Praktiker?
Jörn Pötting:
Wir machen viele Machbarkeitsstudien, auch zum Umbau und Neubau. Bestandumbau ist relativ anspruchsvoll. Am günstigsten sind Gebäude, die als Stahlbeton-Skelettbau konstruiert sind – ähnlich wie Parkhäuser. Es gibt immer einen Boden und dann Stützen, davor hängt eine Glasfassade. Die sind klasse, weil man die Trennwände – oft aus Gipskarton – rausnehmen kann. Man kann das Ganze entkernen und dann neue Grundrisse einplanen. Man kann auch, wenn es zum Beispiel in Kaufhäusern oder großen Gewerbeimmobilien große Ebenen gibt, Lichthöfe in diese tiefen Gebäude schneiden. Das geht relativ einfach und man kann über Atrien Licht in die Gebäude bringen. Da ist viel möglich.
Ich glaube auch, dass gerade mit dem Thema Wandel der Innenstädte – also die digitale Umkrempelung der Stadt, Homeoffice, Amazon usw. – sehr viel möglich ist. Aber man muss dann auch immer sehr genau rechnen. Brandschutz ist ein Riesenthema. Auch die Frage, ob es schädliche Substanzen gibt, also Schadstoffbelastung, ist ein Thema. Und Altbaukonzepte sind immer ein bisschen risikobehaftet, weil man nie so richtig weiß, was auf einen zukommt.
Es gibt Gebäude aus den 50er Jahren, die aus Trümmerschutt gebaut sind. Man weiß gar nicht, was für eine Betonklassifikation die haben. Und wir sind in Deutschland, wo alles genormt sein muss, alles überprüfbar sein muss. Man begibt sich da manchmal auf einen risikoreichen Pfad. Und Investoren müssen genau kalkulieren. Dass man, wenn man investiert, auch genau weiß, wie das Budget ist, ist sehr wichtig – fast das Wichtigste bei diesen Immobilieninvestitionen. Nichts ist schlimmer, als wenn das Budget nachher zu eng wird. Da ist die schönste Idee dahin.
Claudia Mattheis:
Wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest – als Macher und Kenner der Branche – und es gibt ja einen Riesenmarkt, unheimlich viele Leute suchen solche Immobilien: Was würdest du dir wünschen, damit wir hier in Deutschland endlich ins Machen kommen und solche Wohnprojekte auch wirklich umsetzen können? Müssten sich rechtliche Rahmenbedingungen ändern, Finanzierungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten? Was müsste passieren? Müssten mehr Privatinvestoren motiviert werden, Family Offices, wo irgendwie Geld rumliegt und die nicht wissen, wohin damit?
Jörn Pötting:
Meine Idee wäre, eine Vielzahl von Akteuren zu mobilisieren. Auf der einen Seite: die Kommunen und Gemeinden zu sensibilisieren, dass das ein interessantes Thema ist – dieses gemeinschaftliche Mietwohnen, dieses Co-Housing. Denn wir haben die Möglichkeit, aktiv Senioren aus großen Wohnungen oder Eigenheimen anzuziehen. Diese Immobilien können dann wieder von Jüngeren genutzt werden. Und man reduziert durch diese Gemeinschaftsmietwohnprojekte ganz klar den zukünftigen Pflegebedarf. Denn wenn Senioren zufrieden miteinander leben und sich selbst ein Stück kümmern, entlastet das die Kommunen wirklich ganz ordentlich.
Wir alle kommen in eine Pflegebedürftigkeit, klar. Aber die Erfahrung zeigt, dass diese Projekte den Eintritt in die schwere Pflege – also Pflegegrad 4 und 5 – eindeutig nach hinten verschieben und auch die Aufenthaltsdauer, wenn man dann wirklich schwer pflegebedürftig wird, verkürzen. Das ist wirklich ein tolles Gemeinschaftsthema.
Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinden das sehen und Flächen dafür zur Verfügung stellen. Auch dass zum Beispiel die Kirchen – die über erhebliche Flächenreserven in Deutschland verfügen – erkennen, dass das ein gesellschaftliches Thema ist, das es zu initiieren gilt. Das hat tolle ethische Werte, finde ich.
Dann würde ich mir wünschen, dass das in unserer Generation als ein interessantes Thema ankommt, mit dem wir uns beschäftigen. Ich würde auch an uns Boomer appellieren: Beschäftigt euch mit dem Altwerden. Vertraut nicht darauf, dass die Rente reicht. Vertraut nicht darauf, dass die Pflegeplätze reichen. Vertraut nicht darauf, dass irgendwie jemand im Alter euch pflegen kann. Es wird nicht so sein.
Und dann würde ich mir wünschen, dass Investoren erkennen, dass es eine wirklich interessante Investitionsmöglichkeit ist, ein sauberes Geschäft zu machen. Ein gutes Geschäft ist ja immer das, was für alle Beteiligten von Vorteil ist. Jemand investiert in ein Produkt, das wirklich nachgefragt wird, das Sinn macht, das gebraucht wird. Das würde jeder gute Kaufmann so bejahen. Also Immobilienwirtschaft kann auch ein sehr ordentliches, für die Gesellschaft wertvolles Engagement sein.
Und natürlich auch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die eher Daseinsvorsorge im Augenblick machen. Ich finde es sehr schade, dass die Wohnungsbaugesellschaften nicht ein bisschen weiter denken und auch solche Projekte unterstützen, sondern sich sehr auf die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum beschränken. Wenn ich das so sehe, wird das in Zukunft eher Probleme machen. Denn die Leute, die dort wohnen, werden auch alle alt. Die jungen Leute bekommen Kinder, die brauchen irgendwann Kindergärten. Ich sehe nicht, dass Quartiersgedanken da so weit mitgedacht werden. Das würde ich mir wünschen.
Claudia Mattheis:
Aber das klingt schon mal nach machbaren Plänen – erstmal so für mich als Laie, wo ich denke: Ja, okay, das ist also eine Riesenaufgabe, aber eigentlich muss man das bloß alles zusammenführen und daraus dann Gesetze oder Abstimmungsvorlagen machen oder irgendwie die ganzen Protagonisten zusammenbringen. Es gibt ja auch schon einzelne erste Initiativen, aber es ist tatsächlich – wie du auch meinst – bei den meisten Menschen aus der Boomer-Generation noch nicht angekommen. Dass es da wirklich ein massives Problem auch gibt, das nicht kleiner wird, wenn wir drüber schweigen.
Jörn Pötting:
Wir haben ein interessantes Projekt in Eisenhüttenstadt mit der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft, wo wir genau so etwas probieren. Das Spannende ist, dass es eine Genossenschaft ist und das Projekt soll mit Genossenschaftsanteilen finanziert werden. Neben den Akteuren Gemeinden, Kirchen, Zivilgesellschaft würde ich auch die Banken dort sehen. Das ist ein großes Thema: Leute, die älter sind, haben schwer, an finanzielle Ressourcen zu kommen. Und das finde ich ein interessantes Thema, wie man das organisieren kann.
Dort in Eisenhüttenstadt wird das mit einer Genossenschaftsbank organisiert, die dann die Finanzierung auf Genossenschaftsanteile zur Verfügung stellt. Und das finde ich spannende Themen – also wie man Co-Housing-Projekte mit Genossenschaftsprojekten verbinden kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger gesellschaftlicher Input. Der könnte dann auch vom Gesetzgeber wieder finanziell bevorzugt werden.
Ich denke, das ist ein interessantes, großes Thema und es ist wirklich wertvoll, das neben der ganzen Pflegedebatte zu sehen. Denn das ist der Baustein, der vor der Pflege kommt – und der ist so wichtig, weil die eigentliche Pflege wirklich entlastet werden muss und effizienter gestaltet werden muss. Und solche Projekte dienen dazu, Senioren aus der frühen Pflege rauszuhalten.
Claudia Mattheis:
Ja, und vor allem: Ich finde auch, dass man da auf jeden Fall etwas tun muss. Gemeinschaftliche oder genossenschaftliche Wohnformen sind auf jeden Fall auch, glaube ich, ein richtiger Schlüssel. Über das Projekt in Eisenhüttenstadt berichten wir dann auch gerne. Aber meine allerletzte Frage jetzt führt dich zum Schluss: Du bist ja nun Kenner der Materie und weißt, wie man anspruchsvoll und schön wohnt. Wie möchtest du denn selbst im Alter leben und wohnen?
Jörn Pötting:
Ich möchte gerne spannende Sachen erleben. Ich möchte gerne kreativ sein. Ich möchte gerne im Austausch mit anderen Menschen interessante Gedanken haben. Ich würde gerne auch gemeinsam tolle Sachen erleben. Also ich würde ungern allein wohnen. Ich würde gerne mit netten, tollen Menschen inspiriert werden – aber auch meine eigene Wohnung haben. Ich würde gerne auch mit meiner Frau möglichst lange gut zusammenleben und Gemeinschaft dann haben, wenn ich sie will.
Claudia Mattheis:
Also planst du schon dein eigenes Co-Housing-Projekt, wo du mit anderen netten Menschen zusammenwohnst?
Jörn Pötting:
Noch nicht, aber ich finde das spannend. Ich bin noch offen. Ich finde es wirklich eine Qualität. Die Idee zum Beispiel mit anderen Kollegen ein kleines Atelier zu haben, wo wir Architekturmodelle bauen können, oder wo wir zusammen Musik machen können – oder ich interessiere mich für Philosophie, wo wir zum Beispiel kleine Lesungen machen können – finde ich viel interessanter, als in meiner Wohnung oder in meinem Wochenendhaus in Mecklenburg-Vorpommern zu sein.
Claudia Mattheis:
Das ist es. Aber ich finde, diesen Ansatz von dir – den fand ich jetzt wirklich auch absolut neu – dass man einfach sagt: Man labelt quasi auch so ein Projekt, dass man einfach sagt, das ist jetzt das Co-Housing-Projekt für Heavy-Metal-Fans oder für Musikliebhaber oder für Kreative oder für Blumenliebhaber. Dass wirklich Gleichgesinnte zusammenkommen, die dann auf den Gemeinschaftsflächen ihre Leidenschaften auch ausleben können. Ich glaube, das wäre nochmal ein völlig neuer Ansatz.
Jörn Pötting:
Wobei die Kraft eigentlich auch in der Unterschiedlichkeit besteht. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Das ist auch vielleicht das Interessante am Alter, dass man da so ein bisschen gelassener wird. Es ist spannend, dass man überrascht wird von anderen Themen. Dass der Heavy-Metal-Fan vielleicht auch vom Sticken begeistert wird. Oder vom Weben – warum nicht? Das ist doch das Tolle am Alter, dass man sagen kann und auch ein bisschen loslassen kann, dass man jetzt nicht nur immer Lederjacken tragen muss, sondern dass man auch mal töpfern kann.
Claudia Mattheis:
Ja, stimmt schon, das ist ein guter Ansatz. Lieber Jörn, vielen Dank. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiter philosophieren und Ideen ausspinnen. Also Fortsetzung folgt. Wir bleiben weiter im Austausch und gerne berichten wir auch über deine Projekte. Herzlichen Dank.
Jörn Pötting:
Gerne. Danke auch an dich. Danke.
Claudia Mattheis

Claudia Mattheis (Jahrgang 1966) bringt mit 30 Jahren Führungserfahrung als Geschäftsführerin einer Werbeagentur und Chefredakteurin von Print- und Online-Medien strategische Expertise und ein starkes Netzwerk mit. Diese Kombination bildet das Fundament für ihre Mission: LIVVING.de zur führenden deutschsprachigen Plattform für Wohnen & Leben 50plus zu entwickeln. Ihre Leidenschaft für zielgruppengerechte Kommunikation verbindet sie mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Generation 50plus. Als versierte Netzwerkerin schafft sie Verbindungen zwischen Partnern, die gemeinsam die Lebenswelt einer wachsenden demografischen Gruppe neu denken wollen. Mit ihrem Mann Siegbert Mattheis lebt sie in Berlin-Prenzlauer Berg.
Service-Wohnen: Selbstständig leben und gleichzeitig gut versorgt sein
Interview mit Birgit Welslau: Welche Wohnform passt zu mir im Alter?
Interview: Vom Bürogebäude zur Senioren-WG. Ein Wohnmodell für die Zukunft?
Interview mit Birgit Danschke: Wie funktioniert gemeinsames Wohnen im Alter?
Pflege-WG auf dem Bauernhof: Pflegebauernhof bietet Wohnen im Grünen mit Familienanschluss